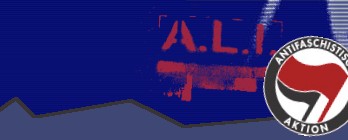Antifaschistische Geschichtspolitik
 70 Jahre nach der Befreiung vom deutschen Faschismus erscheint antifaschistische Geschichtspolitik wichtiger denn je. Erinnergskultur und die Zukunft des Antifaschismus. In Zeiten, in denen es von 1998 bis 2005 unter Rot-Grün einen postulierten staatlichen Antifaschismus in der BRD gegeben hat und die Rolle der antifaschistischen Bewegung dadurch uneindeutig wurde. In Zeiten, in denen spätestens seit der Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006 eine Kampagne betrieben wurde, in denen die deutsche Bevölkerung wieder ein positives Bewusstsein zur deutschen Nation entwickeln sollte bzw. durfte ("Du bist Deutschland"). Und in Zeiten, in denen letzte ZeitzeugInnen des deutschen Faschismus als authentische VermittlerInnen jener Zeit sterben.
70 Jahre nach der Befreiung vom deutschen Faschismus erscheint antifaschistische Geschichtspolitik wichtiger denn je. Erinnergskultur und die Zukunft des Antifaschismus. In Zeiten, in denen es von 1998 bis 2005 unter Rot-Grün einen postulierten staatlichen Antifaschismus in der BRD gegeben hat und die Rolle der antifaschistischen Bewegung dadurch uneindeutig wurde. In Zeiten, in denen spätestens seit der Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006 eine Kampagne betrieben wurde, in denen die deutsche Bevölkerung wieder ein positives Bewusstsein zur deutschen Nation entwickeln sollte bzw. durfte ("Du bist Deutschland"). Und in Zeiten, in denen letzte ZeitzeugInnen des deutschen Faschismus als authentische VermittlerInnen jener Zeit sterben.
Am 15. Mai 2015 diskutierten wir mit der ALF in Freiburg Geschichtspolitik,
Veranstaltungsbericht 2014 | Broschüre | Stadtplan | Gimmicks |
bisherige Geschichtspolitische Projekte seit 2010
2014: Veranstaltung "Antifaschistische Geschichte und Erinnerungskultur in Göttingen"
 Zur Zeit des deutschen Faschismus befand sich mitten in der Göttinger Innenstadt - im Gebäude der heutigen Stadtbibliothek in der Gotmarstr. 8 - das Polizeigefängnis. Zwischen 1933 und 1945 wurden hier über hundert AntifaschistInnen eingesperrt. 111 Namen sind uns bisher nach aufwändigen Recherchen bekannt. Am heutigen Gebäude der Stadtbibliothek erinnert nichts an jene, die hier der faschistischen Verfolgung ausgesetzt waren. Seit zwei Jahren kommt Bewegung in die Diskussion darüber, wie der historische antifaschistische Widerstand in Göttingen öffentlich gewürdigt werden sollte: Bietet sich das damalige Stadthaus als authentischer Ort der Erinnerung an? Können ehemalige Gefängniszellen der Öffentlichkeit als Erinnerungsort zugänglich gemacht werden? Wird es eine Gedenktafel geben und wenn ja, wer soll darauf genannt werden? Wie wird in diesen Diskussionen Widerstand definiert?
Zur Zeit des deutschen Faschismus befand sich mitten in der Göttinger Innenstadt - im Gebäude der heutigen Stadtbibliothek in der Gotmarstr. 8 - das Polizeigefängnis. Zwischen 1933 und 1945 wurden hier über hundert AntifaschistInnen eingesperrt. 111 Namen sind uns bisher nach aufwändigen Recherchen bekannt. Am heutigen Gebäude der Stadtbibliothek erinnert nichts an jene, die hier der faschistischen Verfolgung ausgesetzt waren. Seit zwei Jahren kommt Bewegung in die Diskussion darüber, wie der historische antifaschistische Widerstand in Göttingen öffentlich gewürdigt werden sollte: Bietet sich das damalige Stadthaus als authentischer Ort der Erinnerung an? Können ehemalige Gefängniszellen der Öffentlichkeit als Erinnerungsort zugänglich gemacht werden? Wird es eine Gedenktafel geben und wenn ja, wer soll darauf genannt werden? Wie wird in diesen Diskussionen Widerstand definiert?
Am Mittwoch, den 23. Juli 2014 besuchten rund 70 Menschen die Veranstaltung in der heutigen Stadtbibliothek. Der gut einstündige Vortrag wurde als "szenische Veranstaltung" inszeniert, indem zwischendurch mehrmals Menschen, die sich im Publikum befanden, aufgestanden sind, um einen Teil der 111 Namen vorzutragen. Diese Namensnennungen haben andere Menschen, die sich unter die ZuhörerInnen gemischt hatten, jedes Mal durch kritische Nachfragen wie "Das sind doch viel zu viele! Wie sollen die denn alle auf eine Tafel passen?", "Warum nennt ihr nicht diejenigen Antifaschisten, die von den Nazis ermordert wurden und damit die größten Opfer gebracht haben?" oder "Bezieht ihr euch bei den Namen etwa nur auf Polizei- und damit auf Feindes-Quellen?!" unterbrochen. Durch diese Art und Weise haben wir selbst die kritischen Punkte bei den Überlegungen, wer auf einer Gedenktafel genannt werden sollte, in die Diskussion gebracht. 











Höhepunkt des Abends war die Präsentation einer provisorischen Gedenktafel, die wir erstellt haben: Mittlerweile ist es über zwei Jahre her, dass der Kulturausschus der Stadt Göttingen eine Gedenktafel beschlossen hat für alle, die während des deutschen Faschismus Widerstand geleistet haben und die an der heutigen Stadtbibliothek angebracht werden soll. Diese Tafel ist leider noch nicht in Sicht. Deshalb haben wir ein wetterfestes Provisorium hergestellt, dass der Stadtbibliotheksleitung noch übergeben wird. Die provisorische Gedenktafel ist dafür gedacht, dass sie jetzt schon so oft oder so lange an der Außenfassade der Bibliothek aufgehängt werden kann, bis die eigentliche Mamortafel fertig diskutiert und umgesetzt ist.
In der Nacht zum Mittwoch wurde außerdem in eine andere Debatte der Erinnerungskultur interveniert: Vor den Häusern Gotmarstraße 9, das sich direkt gegenüber der Stadtbibliothek befindet und Gotmarstraße 4, das sind drei Häuser weiter links der Stadtbibliothek befindet, wurden vorläufige Stolpersteine mit Sprühfarbe angebracht. Göttingen ist fast die einzige Stadt in Deutschland, in der es noch keine Stolpersteine gibt. Die damaligen jüdischen bzw. kommunistischen BewrInnen sind durch verschiedenen Geschichten mit der damaligen Polizeiwache verbunden:
In der Gotmarstraße 4 wohnte im Dachgeschoss das kommunistische Ehepaar Louise und Karl Meyer. Beide waren Mitglied in der KPD und Louise Meyer war außerdem eine der drei Hauptkassiererinnen der Roten Hilfe in Göttingen. Der Luftschutzbunker für die Straße befand sich ausgerechnet im Keller der Polizeiwache. Als verfolgte KommunistInnen gingen die Meyers aus Angst eigentlich nicht in diesen Bunker. Nur einmal, im November 1944, als die Universitätsbibliothek, die sich direkt hinter dem Stadthaus befand, bombadiert wurde, gingen sie dort hinein. Ein Granatsplitter traf tatsächlich die Wohnung der Meyers und zerstörte Louises Nähmaschine. 

In der Gotmarstraße 9 wohnte und arbeitete vor und in den Anfangszeiten des deutschen Faschismus die jüdische Familie Jacob. Das Haus wurde damals mehrfach von Nazis angegriffen, indem sie z.B. die Scheiben des Geschäftes eingeworfen haben. Hermann Jacob betrieb dort eine Lederwarenhandlung. Sein Geschäft und später sein ganzes Haus musste er unter Wert verkaufen. Er konnte mit seiner Frau nach Argentinien fliehen und dadurch den Faschismus überleben. Hermann Jacob war der Schwiegervater des Rote-Hilfe-Rechtsanwalts Walter Proskauer, der mit Margarethe Jacob verheiratet war. Im zweiten Stock des Hauses Gotmarstr. 9 wohnte außerdem die jüdische Geschaftsfrau Käthe Meininger, dessen Wohnungseinrichtung von den Nazis mindestens ein Mal kurz und klein geschlagen wurde. Bei allen Angriffen der Nazis schaute die Polizei, die direkt gegenüber in der heutigen Stadtbibliothek untergebracht war, tatenlos zu.


Hier könnt Ihr Euch den Veranstaltungsflyer und hier das Veranstaltungsplakat downloaden.
Broschüre
 Auf 50 Seiten rahmen wir unsere bisherigen geschichtspolitischen Überlegungen seit 2010 zu einem konzeptionellen Ganzen. Die Broschüre enthält folgende Bereiche:
Auf 50 Seiten rahmen wir unsere bisherigen geschichtspolitischen Überlegungen seit 2010 zu einem konzeptionellen Ganzen. Die Broschüre enthält folgende Bereiche:
- Antifaschistische Traditionslinien
- Die Rolle von ZeitzeugInnen in gegenwärtiger antifaschistischer Politik
- Geschichtspolitik in Gedenkstätten
- Internationalistische Geschichtspolitik
- Antifaschistische Biographien und Ereignisse aus Göttingen mit Schwerpunkt der KPD
- Die Zukunft der Erinnerungskultur
Die Broschüre ist mit zahlreichen Fotos unserer geschichtspolitischen Aktionen seit 2010 illustriert. Sie kann bei uns per Email bestellt werden oder direkt im Buchladen Rote Straße abgeholt werden.
Hier könnt Ihr Euch die Broschüre als pdf downloaden.
Antifaschistische Geschichtspolitik
Eine Broschüre in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung antifaschistischer Kultur e.V.
Der Druck dieser Broschüre wurde gefördert durch die Göttinger Kulturstiftung, den Fachdienst Kultur der Stadt Göttingen sowie dem Solidaritätsfonds der Hans-Böckler-Stiftung.
In Kooperation mit der Rosa-Luxemburg Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen
Antifaschistische Geschichtspolitik
y la hacen los pueblos.
Präsident Salvador Allende
Santiago de Chile | 11. September 1973
Antifaschistische Geschichtspolitik ist wichtiger denn je. In Zeiten, in denen es von 1998 bis 2005 unter Rot-Grün einen postullierten staatlichen Antifaschismus in der BRD gegeben hat und die Rolle der antifaschistischen Bewegung dadurch uneindeutig wurde. In Zeiten, in denen spätestens zur Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006 eine Kampagne betrieben wurde, in denen die deutsche Bevölkerung wieder ein positives Bewusstsein zur deutschen Nation entwickeln sollte bzw. durfte („Du bist Deutschland“). Und in Zeiten, in denen letzte ZeitzeugInnen des deutschen Faschismus als authentische VermittlerInnen jener Zeit sterben.
Wie der Begriff es schon sagt, gründet sich antifaschistische Politik per se auf einem historischen Bezug zum Antifaschismus der 1920er und 1930er Jahre, der sich gegen den aufkommenden Faschismus in Deutschland und Europa entwickelt hat. Es ist an uns, diese Geschichte als die unsere zu begreifen, kritisch zu hinterfragen und für unsere gegenwärtigen Kämpfe fruchtbar zu machen. Fast 70 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus in Europa stehen wir vor der Herausforderung, antifaschistische Geschichte weiterzuschreiben, weiterzuerzählen und dadurch zu vermitteln. Dieser Aufgabe müssen sich antifaschistische Strömungen in ganz Europa stellen. In Deutschland stehen wir im Land der TäterInnen dabei vor besonderen Herausforderungen. Als lokal verankerte Gruppe versuchen wir in Göttingen geschichtspolitische Debatten anzustoßen und zu beeinflussen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir bundesweit antifaschistische Politik innerhalb der nächsten Jahre neu ausrichten müssen. In den nächsten Jahren wird sich unserer Einschätzung nach die Identität antifaschistischer Politik zwangsläufig verändern, sobald es keine ZeitzeugInnen des deutschen Faschismus mehr gibt. Nicht zuletzt verweisen die immer größer werdende Schwäche bzw. die Auflösung von bundesdeutschen Antifagruppen auf diese drängenden Aufgaben und Fragen.
Wir nehmen uns als Gruppe antifaschistischer Geschichtspolitik seit 2005, seit dem 60. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus, an. Im Laufe der Jahre haben wir unsere inhaltliche Ausrichtung und die praktische Umsetzung von Aktionsformen weiterentwickelt. 2010 haben wir uns anlässlich des 65. Jahrestages der Befreiung vom deutschen Faschismus mit der Geschichte der deutschen ArbeiterInnenbewegung zwischen 1918 und 1945 beschäftigt. Dabei haben wir den Blickwinkel antifaschistischer WiderstandskämpferInnen, die in Deutschland aktiv waren, eingenommen. 2011 bereicherten wir diesen Standpunkt um eine internationalistische Perspektive, indem wir in Göttingen die Ausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ vom Rheinischen JournalistInnenbüro präsentierten und entsprechende inhaltliche Auseinandersetzungen führten. 2012 lenkten wir unseren Blick auf die lokale antifaschistische Geschichte in Göttingen. Wir führten historische, regionale Recherchen zur Geschichte des antifaschistischen Widerstands in Göttingen durch. Dabei stellten wir kommunistische Strukturen und Aktivitäten in den 1930er Jahren in den Mittelpunkt. Diese Geschichte wird in den bisherigen lokalpolitischen Diskussionen kaum gewürdigt. Es ist an uns, antifaschistische Geschichte sichtbar zu machen. Der Teil hierzu in der vorliegenden Broschüre kann auch über Göttingen hinaus Beispiel dafür sein, wie wir uns als AktivistInnen Geschichte selber aneignen und anderen nahe bringen können. Nach diesen „Ausgrabungen“ und Neu-Ordnungen unserer eigenen Bewegungsgeschichte fingen wir 2013 an, uns mit der Vermittlung antifaschistischer Geschichte zu beschäftigen und probierten verschiedene Aktionsformen und Medien dafür aus. Die Fotos in dieser Broschüre dokumentieren unsere geschichtspolitischen Aktionen seit 2010.
Die vorliegende Publikation führt die inhaltlichen Auseinandersetzungen der letzten Jahre zu einem konzeptionellen Ganzen zusammen. Unsere Überlegungen und Analysen basierten stets auf gründlichen (Literatur-)Recherchen und intensiven Diskussionen darüber in unserer Gruppe. Die Hinweise „Zum Weiterlesen“ stellen jeweils eine Auswahl aus der Hauptliteratur dar, die wir zum entsprechenden Thema diskutiert haben. Wir haben uns für dieses Format und explizit gegen Fußnoten und direkte Belege im Text entschieden, weil wir Teil einer kämpfenden Bewegung sind, in der wir Diskussionen um Inhalte und Aktionsformen führen wollen, und nicht im Uniseminar versauern wollen. In diesem Sinne hoffen wir auf Auseinandersetzungen zur Konzeption antifaschistischer Politik, die wir mit dieser Broschüre weiterführen wollen.
Hasta la victoria siempre!
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft: umkämpfte Deutungen
wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.
George Orwell | 1984
Antifaschistische Geschichtsarbeit ist für uns kein Selbstzweck, sondern schafft Bewusstsein und Kompetenzen in drängenden Auseinandersetzungen der Gegenwart. Auch mehrere Dekaden nach der Befreiung vom deutschen Faschismus kommt der Auseinandersetzung mit Geschichte hierzulande weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Die Deutungsmacht über Geschichtsschreibung ist hart umkämpft: In Dresden führten Neonazis bis 2011 die größten Aufmärsche nach Ende des deutschen Faschismus in Westeuropa durch. Ihr Ziel ist es, Geschichte zu verkehren und die Deutschen zu den eigentlichen Opfern des Krieges zu erklären. Der Staat unterstützt die Neonazis in diesem Vorhaben, indem antifaschistischer Widerstand dagegen kriminalisiert wird. Die Neonazis knickten nach antifaschistischen Massenblockaden und militanten Auseinandersetzungen 2010 und 2011 mit ihren jährlichen Aufmärschen endlich ein. Das Konfliktfeld ist damit allerdings nicht abgeschlossen: Erst drohte das kleine Städtchen Bad Nenndorf in der Nähe Hannovers, dann Magdeburg, zur Geschichtsverdrehung durch Neonazis herzuhalten und die symbolische Bedeutung Dresdens einzunehmen.
Mit einem Standpunkt des antifaschistischen Widerstands befinden wir uns innerhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft in einer Minderheitenposition. Der deutsche Faschismus hat gründliche Arbeit geleistet: Vielfach sind die Traditionslinien der linken ArbeiterInnenbewegung in den KZs abgerissen. In anderen Ländern wurden Faschismus und Besatzung durch mutigen antifaschistischen Widerstand bekämpft und teilweise aus eigener Kraft besiegt. In Deutschland hingegen gibt es fast keine derartigen Bezüge. Die Nazis mussten von den alliierten Armeen niedergekämpft werden, die Gesellschaft von außen vom Faschismus befreit werden.
Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Geschichtspolitik und die Deutungshoheit über Geschichtsschreibung stellen eine Konsequenz aus dem Umgang in der BRD mit dem faschistischen Deutschland dar. Bis in die 1990er Jahre hatten Kontinuitäten von alten Nazi-Eliten und Strukturen in Staat und Gesellschaft vorgeherrscht. Die westlichen Alliierten bauten die spätere BRD ab 1945 zu einem kapitalistischen Frontstaat gegen die Sowjetunion aus. Dabei bedienten sie sich häufig der alten Nazis: Juristen, die im Faschismus für die Nürnberger Gesetze zuständig waren, waren nach 1945 an der Ausarbeitung der bundesdeutschen Verfassung beteiligt. Der Nazi-Marinerichter Hans Filbinger, der kurz vor Kriegsende Deserteure zum Tode verurteilte, wurde nach Kriegsende von den Briten an seinem bisherigen Gericht wieder eingesetzt. Er trat in die CDU ein und wurde von 1966-1978 Ministerpräsident Baden-Württembergs. Hanns Martin Schleyer war erst NS-Funktionär, nach 1945 Wirtschaftsfunktionär. Von 1973 bis zu seinem Tod 1977 durch die RAF war er Arbeitgeberpräsident und Vorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Dies sind nur einige Beispiele. Die westdeutsche Sichtweise von der „Stunde Null“ nach Ende des Faschismus verleugnet diese personellen und strukturellen Kontinuitäten.
Innerhalb dieser gesellschaftlichen Kontinuitäten fehlt es in Deutschland bis heute an Mitleid mit den Opfern faschistischer Gewalt. Antifaschistischer Widerstand ist vor diesem historischen Hintergrund in Deutschland für viele undenkbar, denn er stellt für den Staat mit seinen Polizeien und Geheimdiensten auch heute noch eine feindliche Handlung dar. Für uns ist antifaschistischer Widerstand unser Standpunkt einer Minimalposition - das Vorzeichen für gesellschaftliche Interventionen der Linken.
Die grundsätzlich staatsfeindliche Haltung des antifaschistischen Politikansatzes geriet Ende der 1990er Jahre ins Wanken, als SPD und Grüne gemeinsam die Bundesregierung übernahmen. Glaubwürdiger als die Konservativen verkündeten sie, aus dem Faschismus gelernt zu haben, sich der Verantwortung, die aus der Geschichte resultiert, zu stellen, anstatt sie unablässig zu leugnen. Alt- und Neonazis wurden öffentlich problematisiert, Mahnmale gebaut und die ZwangsarbeiterInnen-Entschädigung zumindest angefangen.
Mit diesen vordergründigen Verlautbarungen und Handlungen, mit denen sie sich als echte Nazi-GegnerInnen darstellen, konnten gleichzeitig allerdings vormals tabuisierte Handlungsmöglichkeiten zur Normalität erhoben werden: Im März 1999 führte Rot/Grün den ersten deutschen Angriffskrieg nach 1945. Unter dem herbei gelogenen Vorwand „ein neues Auschwitz verhindern zu wollen“ (damaliger Außenminister Joseph Fischer, Grüne) bombardierte deutsches Militär zum dritten Mal im zwanzigsten Jahrhundert die jugoslawische Hauptstadt Belgrad. Dem entgegen stellen wir 70 Jahre nach Ende des deutschen Faschismus unser deutliches „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“
Es ist offensichtlich, dass mit Geschichte Politik gemacht wird. Durch Auslassungen und Hervorhebungen geschichtlicher Ereignisse und Zusammenhänge, durch Deutungen und Verdrehungen wird ein historisches Bild von sich selbst und den anderen geschaffen, das eigenes Handeln rechtfertigen und dieses für zukünftige Interessen nutzbar machen soll. In Deutschland sind wir in den letzten Jahren ZeugInnen einer ganzen Reihe von nachhaltigen Begriffsumdeutungen in wichtigen historischen Kontexten geworden, wobei die Politik von Rot/Grün nur einen Gipfel der geschichtsbezogenen Ereignisse darstellte. Das veränderte Geschichtsbild in Deutschland befeuert einen chauvinistischen Nationalismus. Wer hierzulande „stolz auf Deutschland“ sein will, wird versuchen die empfundene Beschädigung der nationalen Identität wegzuwischen. Die Erzählung der geschichtlichen Ereignisse wird vereinfacht und umgedeutet. Mithilfe des so geschaffenen Geschichtsbildes gelingt es, sich der Nation positiv zuzuordnen. Nationalistische Selbstbilder und latente Schlussstrichmentalität in der Mehrheitsgesellschaft nehmen seit dem veränderten Umgang mit Geschichte unter Rot/Grün zu. Denn auf der Seite der Täter des deutschen Faschismus zu stehen, stört die nationalistische Identifikation. Daher werden reale Konflikte und Kämpfe in der deutschen Gesellschaft im Sinne des „Allgemeininteresses der Nation“ ausgeblendet. Ein gängiges Konzept ist die Trennung zwischen „anständigen Deutschen“ und „bösen Nazis“.
Wer sich in Ritualen als geläutert präsentiert, darf den Fokus auch wieder auf „die eigenen Opfer richten“, so lautet die Staatsräson. Selbstmitleid wird zelebriert, wie bspw. in den Erzählungen über die „Bombennächte“. Selbstgefällig werden historische Zusammenhänge von Ursache und Wirkung ausgeblendet und historische Lehren aus dem deutschen Faschismus umgedeutet. In den Medien wurde um dem 70. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die faschistische Wehrmacht in Stalingrad, weinerlich über die „armen deutschen Soldaten“ berichtet. Über solche punktuellen Situationen hinaus wird massenmedial immer wieder vom Zweiten Weltkrieg als die „große Katastrophe“ gesprochen – als wäre eine Naturgewalt über die Menschen gekommen und nicht ein von Menschen gemachtes Verbrechen. Der deutsche Faschismus wird in Schulbüchern mit der DDR zu „den zwei Diktaturen“ vermengt – als wäre der industrielle Massenmord an 6 Mio. Jüdinnen und Juden mit der gesellschaftlichen Situation in der DDR vergleichbar. Die Kriegsschuld und das verbrecherische Handeln werden in subjektiv eingefärbten Erzählungen vollkommen auf den Kopf gestellt. Dies schafft ein gesellschaftliches Klima, an dem der Geschichtsrevisionismus von Neonazis nahtlos anschließen kann.
Der chauvinistische Nationalismus richtet sich seit einigen Jahren mit neuer Qualität gegen Bevölkerungsgruppen im inneren wie auch aggressiv ökonomisch und militärisch nach außen: Bspw. sollen sich MigrantInnen mittels Einbürgerungstests einer vermeintlichen „deutschen Leitkultur“ unterwerfen. Der Terror durch die Neonazi-Geheimdienststruktur NSU wurde öffentlich rassistisch als „Döner-Morde“ abgetan.
Die Bundeswehr agiert seit 1998 nicht nur als Angriffsarmee gegen Serbien, sondern auch in Afghanistan und am Horn von Afrika. Seit 2011 machen sich in der deutschen Außenpolitik neoimperialistische Tendenzen verstärkt gegen EU-Staaten bemerkbar: Die Finanzkrise wird dazu genutzt, Europas Süden nach deutschen Interessen zu formen. Ungeniert werden Regierungen installiert, die den Kapitalismus gegen die Krise und soziale Bewegungen autoritär abzusichern haben. Begleitet wird diese Politik von einer immer abstoßenderen rassistischen Überheblichkeit gegenüber Menschen aus den betroffenen Ländern.
Gedenkstätten & Geschichtspolitik
Das Selbstverständnis der BRD spiegelt sich zwangsläufig auch in der Gedenkkultur wider. Interessant ist ein Vergleich der Gedenkkulturen in der BRD und der DDR. Der antifaschistische Widerstand und die Rolle der KommunistInnen war in der DDR Teil der Staatsideologie. Das Handeln der Antifaschisten im KZ Buchenwald bei Weimar nahm dabei eine besondere Bedeutung ein. In umfangreicher Erinnerungsliteratur und Filmen wie „Nackt unter Wölfen“ (1963 DEFA nach dem gleichnamigen Roman des ehemaligen Buchenwald-Häftlings Bruno Apitz) wurden die Verbrechen des Faschismus dokumentiert und der Widerstand positiv wiedergegeben. Ziel war es, die Weltöffentlichkeit und insbesondere auch die eigene deutsche Bevölkerung im Sinne eines „Nie wieder Faschismus!“ aufzuklären. Problematisch war der letztendlich „verordnete staatliche Charakter“ dieses Antifaschismus und die teilweise vereinfachende Sicht, die auf die Rolle der KommunistInnen verengt wurde oder in der gar Unhistorisches hinzu erfunden wurde. So bereicherten uns die DDR-Geschichtsschreiber um einen offenen Sturm der Häftlinge auf das Torhaus des Konzentrationslagers Buchenwald, den es so in der Wirklichkeit nicht gegeben hatte.
Dem gegenüber stand in der BRD eine durch die Kontinuität der alten Nazi-Eliten und krassem Antikommunismus geprägte Verdrängungskultur. Ehemalige KZ-InsassInnen sahen sich in den 1950er Jahren im Rahmen des KPD-Verbotes vor Gericht bald ihren alten Nazi-Richtern erneut gegenüber. Erst mit den sozialen Bewegungen der 1960er Jahre gelang es, diese alten Eliten ins Wanken zu bringen. An der zunehmenden Rechts-Entwicklung Deutschlands zu einer remilitarisierten, nach Weltmacht strebenden Nation, änderte das jedoch nichts.
Als 1990 die DDR an die BRD angeschlossen wurde, machten sich die kapitalistischen Sieger sogleich auch über die Gedenkstätten des realen Sozialismus her. Seitdem werden die Gedenkstätten entweder mehr und mehr entpolitisiert oder die Geschichtsschreibung verschoben. In einem ersten Schritt wurde die historische Leistung der Buchenwald-Häftlinge, sich selbst befreit zu haben, in Frage gestellt und innerhalb der Gedenkstätten-Ausstellung in den Hintergrund gedrängt. Im neuesten Konzept der Gedenkstätte Buchenwald wird nicht mehr eindeutig vermittelt, wer die Täter, wer die Opfer und wer die Widerstandskämpfer waren. Stattdessen werden alle Akteure des ehemaligen Konzentrationslagers plural nebeneinander gestellt. Die BesucherInnen sollen selber aus diesem wertfreien Sammelsurium auswählen, mit wem sie sich identifizieren und wie sie die einzelnen Akteursgruppen einschätzen wollen.
Eine andere, weitaus aggressivere Haltung konnten wir 2010 in Form von offizieller Geschichtsschreibung bei der 65-Jahrfeier zur Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald erleben. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sprach in seiner Rede davon, dass die „wirkliche Befreiung“ erst vor 20 Jahren, also nach dem Zusammenbruch der DDR, vollzogen worden wäre und verlautbarte damit eine unerträgliche totalitarismustheoretische Position. Eine eindeutige Positionierung bezüglich Tätern, Opfern und WiderstandskämpferInnen nahm in dieser Feier einzig Jorge Semprún vor, der in der französischen Résistance und gegen den spanischen Faschismus gekämpft hat und an der Selbstbefreiung Buchenwalds als kommunistischer Häftling mitgearbeitet hat. Er verstarb am 7.6.2011 in Paris.
In diesem Zusammenhang müssen wir uns als AntifaschistInnen Gedanken über unsere Rolle auf den jährlichen Gedenkfeiern machen, denn die wird sich innerhalb der nächsten wenigen Jahre sehr verändern (können). Je weniger KZ-Überlebende wie Jorge Semprún selbst über das Lager, den Lagerwiderstand und die Selbstbefreiung sprechen können, desto mehr Raum werden StaatspolitikerInnen wie Lammert bekommen und eine Gedenkkultur etablieren, mit der sich AntifaschistInnen nicht identifizieren können. Bisher besteht die Aussage der letzten Überlebenden, dass sie bei der jährlich stattfindenden Gedenkfeier keine politischen Auseinandersetzungen führen wollen. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns daran halten, solange sie selbst noch Teil dieser Veranstaltung sind. Ein bedeutender Unterschied bei den Einflussmöglichkeiten auf die konkrete Gedenkstättengestaltung, liegt in der jeweiligen Trägerschaft der Gedenkstätten. Während einige der großen symbolkräftigen Orte von Landesstiftungen betrieben und kontrolliert werden, sind einige kleinere und teils neuere Gedenkorte von lokalen Trägervereinen mitgestaltet.
Mit dem Anschluss der DDR an die BRD sollten die ehemaligen Gedenkstätten der DDR, Buchenwald und Sachsenhausen, frei nach der Totalitarismus-Theorie in Gedenkstätten für „Opfer von Gewaltherrschaft“ umgearbeitet werden. Neben Opfern des deutschen Faschismus sollte nun auch jenen „des Kommunismus“ gedacht werden. Die kurzzeitige Nutzung ehemaliger KZ-Gelände durch alle Alliierten, um Nazikriegsverbrecher zu internieren, wurde nun ausschließlich der Sowjetunion und der späteren DDR angelastet. Im Zuge dieser Geschichtsverdrehungen findet sich heute auf dem Gelände Buchenwalds eine ständige Ausstellung zum „Sowjetischen Speziallager Nr. 2“.
Auf der anderen Seite wird die bis heute andauernde „Weiternutzung“ ehemaliger KZ-Gebäude in der Öffentlichkeit als unproblematisch empfunden. So wird bspw. das Gelände des ehemaligen Jugend- und Frauen-Konzentrationslagers Moringen (bei Göttingen) als forensische Psychiatrie genutzt. Ebenso hält ein Teil des ehemaligen KZ- und Arbeitslagers Breitenau (bei Kassel) seit 1974 als psychiatrische Einrichtung her. Das Gelände des ehemaligen KZs Fuhlsbüttel in Hamburg wird bis heute als Knast genutzt, das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme in der Nähe Hamburgs wurde bis 2006 ebenfalls als Knast genutzt.
Andere Beispiele verdeutlichen, wie die offizielle Geschichtsschreibung am Widerstand der überlebenden KZ-Häftlinge scheitern kann. Um die Gedenkstätten wurde in der Bundesrepublik von Anbeginn gerungen. Damit diese überhaupt errichtet wurden, bedurfte es jahrelangen Bemühungen der KZ-Überlebenden selbst. So wurde die Gedenkstätte Dachau als erste KZ-Gedenkstätte in der BRD erst 1965 errichtet, nachdem Überlebende zehn Jahre darum gekämpft hatten. In Ravensbrück gab es nach 1989 einen dreisten Vorstoß der Entpolitisierung: das ehemalige Lagergelände sollte als Gewerbegebiet umgenutzt werden. An der „Straße der Nationen“, die Häftlingsfrauen aus dem Konzentrationslager bauen mussten, wurde mit der Errichtung eines Supermarktes begonnen. Der Neubau konnte nur durch Proteste der Häftlingsorganisationen gestoppt werden. Dass diese Proteste vorerst erfolgreich verliefen, hat mit der moralischen Legitimation durch die Überlebenden zu tun. Wenn sie durch die Existenz ihrer Personen keine moralischen Instanzen in den gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen mehr darstellen werden, wird Geschichtsschreibung nur noch nach staatlichen Interessen fungieren. So heißt es in der „Konzeption der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück“ von 2000, dass es die Interessen der Überlebenden „wenigstens so lange zu akzeptieren gilt, wie Überlebende nach Ravensbrück zurückkehren“.
Antifaschismus am Scheidepunkt
Die Deutungshoheit über die Geschichte des Faschismus, der Shoa und des Zweiten Weltkriegs wird sich in den nächsten Jahren noch weiter zu Gunsten der Mächtigen dieser Welt verschieben. Denn von jenen, die in Europa und speziell in Deutschland authentisches Zeitzeugnis ihres antifaschistischen Widerstands, ihres Kampfes in den PartisanInnengruppen oder regulären Armeen der Befreier, ihrer Qualen in den Kerkern und Lagern der Faschisten abgeben könnten, leben immer weniger. Die wenigen noch lebenden ZeitzeugInnen aus dem antifaschistischen Widerstand und den Opfergruppen sind noch dazu altersbedingt oft nicht mehr in der Lage, Auskunft zu geben. Diejenigen, die heute aus eigenem Erleben vom Faschismus berichten können, haben diesen meist als Kinder erlebt. Damit können sie ein begrenzteres Bild jener Zeit wiedergeben als damalige Erwachsene, die die Verhältnisse bewusster erlebt haben. Aber solange die letzten ZeitzeugInnen noch am Leben sind, sehen sich offizielle Institutionen mit der glaubwürdigen Perspektive von Opfern und WiderstandskämpferInnen konfrontiert. Wir gehören zur letzten Generation, die überhaupt noch die Möglichkeit hat mit ZeitzeugInnen in Begegnung zu kommen. Dieser Umstand schafft besondere Herausforderungen bei der Vermittlung von Geschichte.
Insofern finden die Auseinandersetzungen um Geschichte nicht zufällig in diesen Jahren mit solch einer Vehemenz und großer Gegenwehr statt. Denn dadurch, dass die letzten Überlebenden des deutschen Faschismus sterben, befinden wir uns in der Geschichte an einer Art Scheidepunkt. In dem Maße, wie die ZeitzeugInnen nicht mehr in der Lage sein werden, öffentlich ihre Stimme zu erheben, werden sich gesellschaftliche Diskurse zu unseren Ungunsten verschieben.
Der Scheidepunkt, der uns zur Auseinandersetzung mit widerständiger Geschichtsschreibung zwingt, stellt uns nicht nur vor die Herausforderung, antifaschistische Geschichte zu vermitteln, sondern auch vor der strategischen und inhaltlichen Ausrichtung unserer eigenen Politik: Wohin entwickelt sich ein politischer Ansatz, der als „Antifaschistische Aktion“ agiert, wenn kein lebendiges und authentisches Zeugnis von historischen Bezugspunkten mehr existiert?
Eine Organisierung in der Antifa begründet sich für uns unter anderem darauf, dass wir im Land der Täter des deutschen Faschismus leben. Dies schafft ein besonderes Vorzeichen im Bewusst- wie im Unbewusstsein der deutschen Gesellschaft. Unsere politische Denk- und Vorgehensweise gründet sich nicht nur auf dem abstrakten Wissen um die Verbrechen der Nazis, sondern auch auf konkreten, persönlichen Erfahrungen. Die Rolle der ZeitzeugInnen des deutschen Faschismus ist nicht nur gesamtgesellschaftlich wichtig für den Umgang mit Geschichte, sondern auch konkret für unsere Politisierung. Wir haben zum Beispiel selbst Eltern oder Großeltern, die in die Taten des deutschen Faschismus verstrickt waren. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch ZeitzeugInnen treffen, die mit ihrer Weitsicht und mit ihrem Mut im europäischen Widerstand gegen den Faschismus Vorbilder für uns sind. Alle diese Begegnungen lieferten uns persönlich erfahrbare Reibungs- oder aber Identifikationspunkte für unsere politische Arbeit, durch sie bekommt unsere Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Phänomenen rechter Ideologie eine besondere Tiefe. Unsere Generation ist die letzte, die noch eine auf eigenen Erfahrungen basierende moralische und emotionale Haltung gegenüber dem deutschen Faschismus entwickeln kann. Nachkommende Generationen werden keine konkreten Beziehungen mehr zu Akteuren des deutschen Faschismus oder zu WiderstandskämpferInnen erfahren können. Das wird zwangsläufig Auswirkungen auf die Identitätsbildung innerhalb der Konzeption des Antifa-Ansatzes haben. Wenn der historisch erfahrbare Orientierungspunkt nicht mehr vorhanden sein wird, ist die in großen Teilen der Gesellschaft vorhandene Ächtung des historischen Faschismus und die damit verbundene Skandalisierung von Erscheinungsformen des Neofaschismus zukünftig nicht sicher gestellt.
Zugleich zeigt sich heute angesichts der Krise des Kapitalismus deutlicher als selten zuvor, welches Bedrohungspotential in gegenwärtigen Formen autoritärer Herrschaft, des Rechtspopulismus oder offener Neonazis liegt. Immer unverhohlener macht die Priorisierung des Kapitals deutlich, dass man gerne bereit ist, die bürgerliche Demokratie zugunsten der Durchsetzung ökonomischer Interessen hinten anzustellen. Stimmen nach einer „starken Führung“ werden in diesem Zusammenhang wieder lauter. Der Staat hält sich durch seine Geheimdienste bewaffnete Gruppen von Neonazis und wird diese im Zweifelsfall auch für die „Drecksarbeit“ gegen unliebsame Gruppen einsetzen. Antifaschismus wird als gesellschaftskritische Kraft also ein wichtiger Ansatzpunkt der radikalen Linken bleiben.
Offen bleibt, wie der Wandel des politischen Ansatzes von Antifa aussehen wird. Deutlich ist allerdings, dass sich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre Grundsätzliches ändern wird. Möglich ist, dass sich die Spur des Widerstandes gegen den Faschismus – jenseits der persönlichen Begegnung – durch Zeugnis der ZeitzeugInnen weiterträgt. Dafür ist allerdings die Beschäftigung mit der eigenen Bewegungsgeschichte von Nöten. Es müssen in der Auseinandersetzung mit antifaschistischer Geschichte bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse als Bedingung für das Erstarken des Faschismus erkannt werden. Gegenwärtige und zukünftige soziale Kämpfe müssen diese Erkenntnisse mit einbeziehen und so die antifaschistische Idee am Leben erhalten. Vergangenheit ist niemals abgeschlossen, sondern stets die Vorgeschichte der eigenen Gegenwart.
In diesem Sinne erklärt sich Gegenwärtiges nur aus der Geschichte heraus. Wie der deutsche Faschismus das Denken und Handeln bis heute prägt, so leitet sich auch der antifaschistische Widerstand aus seiner eigenen Geschichte ab. Wird politisches Handeln dieses Verständnis betrieben, bleibt es allein reaktiv und bezugslos. Bei der Vermittlung einer antifaschistischen Geschichtsschreibung beziehen wir uns auf eine widerständige Geschichte und stellen uns damit in die moralische und politische Legitimationslinie der überlebenden AntifaschistInnen im Sinne einer – wenn auch brüchigen – Kontinuität des Widerstands. Wir wollen uns nachfolgend mit unserer eigenen Bewegungsgeschichte auseinandersetzen.
Vergessen ist Verweigerung der Erinnerung
Novemberrevolution 1918 und
Generalstreik gegen den Kapp-Putsch im März 1920
Der Kieler Matrosenaufstand lieferte Ende 1918 die Initialzündung für einen allgemeinen Aufstand, der das Ende des Ersten Weltkrieges und des deutschen Kaiserreiches erzwang. In zahlreichen Städten wurden Arbeiter- und Soldatenräte gegründet, die in ihrer Organisationsform selbst einen basisdemokratischen Charakter verwirklichten. Inspiriert durch die Oktoberrevolution 1917 in Russland, hofften viele auf ein Ende von Krieg, Kaiserreich und Kapitalismus. Fast zeitgleich riefen am 9. November 1918 in Berlin der SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann die Republik und Karl Liebknecht (Spartakusbund) die sozialistische Republik aus. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert forderte das Amt des Reichskanzlers für sich.
Die SPD hatte bereits vor 1914 eine nationalistische Position eingenommen und durch ihre Zustimmung zu den Kriegskrediten den Ersten Weltkrieg mit ermöglicht. Dem entgegen stand das deutliche „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“ von Karl Liebknecht. Auch vom Ziel einer proletarischen Revolution zur Überwindung des Kapitalismus hatte sich die Sozialdemokratie abgewendet und propagierte stattdessen „soziale Reformen“ innerhalb der bestehenden Ordnung. Nachdem die SPD dafür Ende 1918 die Ausgangsbedingungen erfüllt sah, setzte sie erneut auf ein Bündnis mit den alten reaktionären Eliten. In den folgenden Monaten ließ sie revolutionäre Aufstände blutig niederschlagen. Im Januar 1919 wurden die beiden kommunistischen ArbeiterführerInnen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von rechten Freikorps-Soldaten ermordet.
Doch diese Taktik blieb ein instabiles Unterfangen. Die alten monarchistischen und rechten Kräfte dankten der SPD ihren Arbeiterverrat nicht. Schon 1920 ging die SPD erneut ein strategisches Bündnis mit den KommunistInnen ein, um den rechten Kapp-Putsch abzuwehren.
Unter kaiserlichen Reichskriegsflaggen und teils mit Hakenkreuzen an den Stahlhelmen marschiert die Marinebrigade Erhardt am 12.3.1920 in Berlin ein. Der Putschversuch rechter Militärverbände scheiterte jedoch an einem politischen Generalstreik unter Führung der Gewerkschaften. Am 15.3.1920 war das gesamte Land still gelegt: in keiner Fabrik wurde gearbeitet, kein Laden wurde geöffnet, so dass den Putschisten keine ökonomische Basis blieb. Geschätzte 12 Mio. Menschen waren im Ausstand, es war der größte Streik in der deutschen Geschichte.
Bis weit ins Bürgertum reichte die Solidarität gegen die rechten Putschisten. SozialdemokratInnen, Gewerkschaften, USPD, KommunistInnen und Unorganisierte bildeten spontan Aktionsausschüsse. Den Kapp-Putschisten war somit jegliche Möglichkeit des Regierens genommen. Bereits am 18.3.1920 flohen sie oder zogen sich, teils blutige Rache nehmend, zurück.
Doch im Zuge dieser Ereignisse bewaffnete sich vielerorts die organisierte ArbeiterInnenschaft und stellte auch weitergehende Forderungen, wie die Entwaffnung der konterrevolutionären Organisationen oder die Enteignung der Schlüsselindustrien. Im Ruhrgebiet führte das zur Aufstellung einer „Roten Armee“, die wenig später nach schweren Kämpfen mit regierungstreuen Freikorps und der Reichswehr zerschlagen wurde.
Die Erfahrungen des erfolgreichen Generalstreiks gegen den Kapp-Putsch lehrten einerseits die Stärke einer einigenden ArbeiterInnenschaft und dienten als Vorbild für die spätere Propagierung der „Einheitsfront-Aktion“ und „Antifaschistischen Aktion“ gegen den bevorstehenden Faschismus. Zugleich dokumentiert die Taktiererei der SPD mit rechten Freikorpsverbänden und deren skrupelloser Einsatz gegen aufständische ArbeiterInnen wiederholt den tiefen Riss, der durch die ArbeiterInnenbewegung ging – und der ihr 1933 mit der Machtübertragung an die Faschisten zum Verhängnis werden sollte.
Historische Antifaschistischen Aktion von 1932
Am 24.5.1932 wurden Abgeordnete der KPD-Fraktion im Berliner Reichstag durch Mitglieder der NSDAP-Fraktion öffentlich angegriffen. Allen Parteien, besonders den ArbeiterInnenparteien, war klar, dass diese Angriffe eine neue Dimension in der Auseinandersetzung mit den Faschisten darstellten. Die KPD-Parteiführung erkannte die Notwendigkeit, eine geschlossene Einheitsfront aller ArbeiterInnenparteien und -organisationen zu bilden.
Bereits am 1.5.1932 forderte der KPD-Parteivorsitzende Ernst Thälmann auf einer Berliner Maikundgebung die „Einheitsfront“. „Wir rufen an dieser Stelle – bei diesem Tempo der faschistischen Entwicklung – den Millionen Unterdrückten in Deutschland, den sozialdemokratischen, freigewerkschaftlichen und christlichen Arbeitern zu: Bildet mit uns gemeinsam die kämpfende aktive Einheitsfront aller Ausgebeuteten gegen die Politik der Bourgeoisie! Wir sagen allen Arbeitern: die Stunde ist gekommen, wo ihr dem Faschismus eine einheitliche kämpfende Front entgegenstellen müßt, um ihm das verbrecherische Handwerk zu legen“.
Am 10. Juli 1932 riefen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und einzelne Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) auf dem Reichseinheitskongress in Berlin die Antifaschistische Aktion gegen den unmittelbar drohenden Faschismus in Deutschland aus. Die Antifaschistische Aktion war auf den ersten Blick ein strategisches Aktionsbündnis von KPD und Teilen der SPD. Die KPD wollte eine Einheitsfront aller AntifaschistInnen aus ArbeiterInnen der KPD, SPD, christlich organisierten ArbeiterInnen, gewerkschaftlich Organisierten und Unorganisierten, Beamten, BäuerInnen, HandwerkerInnen und Intellektuellen schaffen. Anders als erhofft lehnten SPD-Parteiführung und weite Teile der freien Gewerkschaften des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds (ADGB) ein grundsätzliches Zusammengehen in dieser Frage unter der Leitung der KPD ab. Die SPD-Spitze stellte sich gegen die Einheitsfrontpolitik und verbot ihren Mitgliedern die Beteiligung an der Antifaschistischen Aktion. Wer sich dennoch daran beteiligte, musste damit rechnen aus der SPD ausgeschlossen zu werden.
Auf den zweiten Blick aber stellen wir fest, dass diese Initiative nicht (nur) von den Führungen der beiden Parteien abhing. Die Antifaschistische Aktion war vielmehr von der Bewegung selbst geschaffen. Die Verkündung durch die KPD war eher eine offizielle Verlautbarung bereits umgesetzter Kämpfe. Kleinere Abspaltungen wie die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands KAPD hatten schon zuvor auf eine Kurskorrektur gedrängt und an der Basis darauf hin gearbeitet. Eine Antifaschistische Aktion der Basis ist für uns ein positiver Bezugspunkt.
Nach der Abwehr des Kapp-Putsches bildete der am 28.9.1930 gegründete Kampfbund gegen den Faschismus (KGF) einen direkten Vorläufer der Antifaschistischen Aktion. Nachdem der KPD-nahe Rote Frontkämpferbund (RFB) ein Jahr zuvor verboten wurde, sollte der KGF nun die Funktion als „überparteiliche Massenorganisation der Straße“ übernehmen. Auf Grundlage der Einheitsfrontidee organisierten sich in diesem Bund weite Teile der ArbeiterInnenschaft in den Betrieben, Stadtvierteln und Häuserblocks gegen die Faschisten. Mit Ausrufung der Antifaschistischen Aktion 1932 gingen die Ortsgruppen des KGF meist in der neuen Organisation auf.
Der Kampfbund gegen den Faschismus verweist als praktische Initiative zur Organisierung der ArbeiterInnen auf einen zweiten, auf der Handlungsebene wichtigen, Punkt: In ihren Lebensumfeldern leisteten die AntifaschistInnen direkten, teils militanten, Widerstand gegen Faschisten. In der Antifaschistischen Aktion wird dies durch die Idee des Roten Massenselbstschutz fortgeführt. Dieses Konzept wurde aus der Notwendigkeit in den Betrieben und ArbeiterInnenvierteln heraus entwickelt und wurde als überparteiliche Zusammenfassung aller antifaschistischen ArbeiterInnen gesehen. Der Rote Massenselbstschutz kämpfte gegen Faschisten auf der Straße und in den Betrieben und schützte Wohnungen und weitere eigene Orte der ArbeiterInnen. Antifaschistisches Handeln kann also nicht durch völlige Verantwortungsübertragung auf übergeordnete Strukturen wie die Parteiführung umgesetzt werden, sondern muss aus Eigeninitiative in verschiedenen Arten der Auseinandersetzungen geschehen.
Ein dritter uns wichtiger Punkt bestärkt ebenfalls den eigenverantwortlichen Widerstand: Nicht nur die Basis handelte selbstorganisiert, sondern auch die KPD-Führung handelte entgegen der ihr überstehenden Kommunistischen Internationale (Komintern). Die Ausrufung der Antifaschistischen Aktion wurde gegen den Willen der Komintern bzw. der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) umgesetzt.
Die Machtkämpfe innerhalb der KPdSU nach Lenins Tod 1924, die sich vor allem zwischen Stalin und Trotzki abspielten, waren die Grundlage für die „Sozialfaschismusthese“, die in Deutschland verfolgt wurde: Stalin und seine Anhänger bereiteten sich auf einen Kampf vor gegen alle, die nicht ihre Linie verfolgten. Sie trafen Absprachen mit der Leitung der KPD, die auch in Deutschland den Kampf gegen „abweichende Kräfte“ führen sollte. So wurde nun die SPD als „sozialfaschistisch“ betrachtet und musste nach dieser Logik als erstes bekämpft werden. Dies verkannte nicht nur die Gefahr des Faschismus, sondern vertiefte auch die Spaltung und Schwächung der Linken. Die Einheitsfront blieb auf der Parteiführungsebene der KPD an dieser Frage eher ein Lippenbekenntnis als eine wirkliche Strategie.
Der These vom Sozialfaschismus stand die Totalitarismustheorie und -praxis der SPD gegenüber. Der Niederschlagung der revolutionären Kämpfe ließ die SPD 1929 das Verbot des 1. Mai (Blutmai) und das Verbot des RFB folgen. Diese Regierungspraxis begründeten sie mit der Gleichsetzung von KommunistInnen mit den Nazis.
Angesichts der nicht mehr zu ignorierenden faschistischen Gefahr rückte die KPD-Führung dann 1932 unabhängig von der Komintern von der Sozialfaschismusthese ab und beschloss hingegen den Kurs der Antifaschistischen Aktion mit dem Einheitsfrontgedanken. Wir machen uns keine Illusionen. Mit der Machtübertragung an die Nazis verschärfte sich ab Januar 1933 die Situation dramatisch. Die Nazis verfügten jetzt über die Hoheit der staatlichen Strukturen des Gewaltmonopols, die zunächst v.a. gegen die politischen HauptgegnerInnen, die KommunistInnen und SozialdemokratInnen, eingesetzt wurden. Die Parteiorganisationen der Faschisten standen damit gleichzeitig unter einem besonderen Schutz im deutschen Staat: die SA bekam den Status der Hilfspolizei und konnte so unter staatlicher Deckung ihren politischen Kampf weiter führen. Dazu entwickelte sich nun die Polizei zum ausführenden Organ der Faschisten.
Am Tag der Machtübertragung an die NSDAP organisierte die KPD reichsweit Demonstrationen, nach dem „Reichstagsbrand“ versuchte sie (erfolglos) einen „allgemeinen Streik gegen Hitler“ zu organisieren und in den ersten Monaten 1933 kam es in den starken ArbeiterInnenvierteln im Reich weiterhin zu erheblichen Straßenschlachten zwischen AntifaschistInnen und SA. Die Dimensionen der Repression gegen den antifaschistischen Widerstand war aber vollkommen neu und die KPD damit überfordert. Ihre Reichstagsabgeordneten wurden ausgeschlossen, verfolgt und weggesperrt. Die zentralistischen Organisationsstrukturen der Partei wurden durch die Verhaftung von Funktionären entscheidend geschwächt. Unter dem Druck der Verfolgung waren die AntifaschistInnen damit beschäftigt, illegale Strukturen im Inland und im Exil aufzubauen. Ein offensiver Widerstand, der den deutschen Faschismus ernsthaft hätte gefährden können, war nicht abzusehen. Es war deutlich, dass die Strategien von vor 1933 in der neuen Situation nicht hilfreich waren.
Es gab keinen organisierten Plan für den bewaffneten Widerstand gegen den deutschen Faschismus. Anfang März 1933 waren bereits 20.000 KommunistInnen inhaftiert. Gleichzeitig begann die SS mit dem Aufbau des systematischen Netzes der Konzentrationslager.
Widerstand und Selbstbefreiung im KZ-Buchenwald
Trotz der vielfach ausweglosen Lage leisteten AntifaschistInnen auch in den Konzentrationslagern mehr oder weniger vereinzelt oder organisiert Widerstand. Besonders bemerkenswert war der Widerstand im KZ Buchenwald. Dieses mutige und entschlossene Handeln in einer durch und durch bedrohlichen Situation ist für uns ein weiterer positiver Bezug, wobei dies nicht heißen soll, dass wir unsere heutige Politik in irgendeiner Weise mit den Leistungen der widerständigen Häftlinge vergleichen wollen.
Mitte Juli 1937 wurden die ersten Häftlinge ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Unter ihnen waren vorwiegend politische Häftlinge, die sich von vornherein im Lager unter lebensbedrohlichen Umständen um eine Weiterführung ihres antifaschistischen Widerstandes bemühten. Ihr Wille, ihr Mut und ihre entschlossene Organisierung führten 1945 zur einzigen Selbstbefreiung der Häftlinge eines Konzentrationslagers.
Der Selbstbefreiung voraus gingen nicht nur jahrelange Vorbereitungen, sondern auch widerständige Handlungen im Lageralltag. Trotz Widersprüchen und Drahtseilakten entschieden die politischen Häftlinge 1938/1939, Lagerfunktionen zu übernehmen. So konnten sie das Leben der Häftlinge sogleich erleichtern und die Rahmenbedingungen für einen organisierten Widerstand schaffen. Als Antifaschisten konnten sie in der Funktion als Kapos, Blockälteste oder Schreiber für die SS zumindest zum Teil ihren Mithäftlingen und Genossen helfen, wie dem ehemaligen Résistance-Kämpfer und KP-Mitglied Jorge Semprún. Diesen wollte die SS gezielt ermorden, was ein kommunistischer Schreiber in den Häftlingslisten lesen konnte, so dass die Genossen einem Sterbenden aus der Krankenstation seinen Namen gaben und ihm selbst damit das Leben retteten.
Im Sommer 1942 beschloss die illegale Leitung der KPD im KZ Buchenwald einen bewaffneten Kampf gegen die SS und baute eine Militärorganisation auf. Sie gründete das Internationale Lagerkomitee, das zur Aufgabe hatte das Leben der Antifaschisten zu erhalten, kampfbereite Kräfte zusammenzuschließen, die Kriegsproduktion zu sabotieren und die bewaffnete Auseinandersetzung mit der SS vorzubereiten. Auch Häftlinge aus der Sowjetunion, Frankreich, Jugoslawien, Polen, Spanien und anderen Ländern bauten militärische Gruppen auf, die sich zur Internationalen Militärorganisation IMO zusammenschlossen. Von nun wurden Waffen der SS geklaut, Molotowcocktails und Handgranaten selbst gebaut, der Waffenbestand der SS dokumentiert, das Lager bis ins Detail vertraut gemacht. Am Ende hatte die IMO 1 Maschinengewehr, 96 Karabiner, 100 Pistolen, 16 Wehrmachtshandgranaten, 107 eigens gebaute Handgranaten, 1100 Molotowcocktails, 50 Hiebwaffen und 80 bis 100 Stichwaffen.
Mit der konkreten Planung des Aufstands wurde im Sommer 1943 begonnen. Die Funktionshäftlinge im Krankenbau richteten ein, dass die führenden Funktionäre der Leitung, Heiner Studer und Otto Roth, für mehrere Tage krank geschrieben wurden, damit sie in einem Krankenzimmer mit den konkreten Planungen beginnen konnten. Sie erarbeiteten zwei Pläne, den Offensivplan und den Defensivplan. Ersterer lag die Überlegung zugrunde, dass sich zu Kriegsende – ähnlich wie 1918 – eine revolutionäre Bewegung entwickeln würde. In diesem Fall sollte die SS per Überraschungsangriff bekämpft werden, so dass mit deren Waffen Verbände weiterkämpfen können. Ein Jahr später wurde dieser Plan wieder fallengelassen. Der Defensivplan allerdings sollte bei einer akuten Vernichtungsbedrohung des Lagers durch die SS zum Tragen kommen.
Dieser wurde zwei Jahre später in die Tat umgesetzt. Anfang April 1945 war den organisierten Häftlingen klar, dass die Rote Armee kurz vor Berlin und die US-Army 40 km vor Buchenwald stand. Am 5. April 1945 kommt der Befehl von der Lagerleitung, dass „alle Juden auf dem Appellplatz“ antreten sollen. Damit war offenkundig, dass eine Evakuierung, d. h. ein Todesmarsch, kurz bevor stehen sollte. Die widerständigen Häftlinge setzten auf eine Verzögerungstaktik und verbrannten alle Karteikarten, mit denen jüdische Häftlinge hätten ausfindig gemacht werden können. Mehrere hundert jüdische Häftlinge entfernten sich den gelben Stern von der Häftlingskleidung. So waren sie nicht mehr zu identifizieren. Da klar war, dass der deutsche Faschismus in seinen letzten Zügen stand, holten die Widerstandskämpfer am 8. April 1945 die Waffen aus den Verstecken. Die US-amerikanische und die Rote Armee wurden von den Häftlingen angefunkt, dass sie Unterstützung brauchen. Mittags um 12 Uhr erschien nach Aufforderung durch die SS niemand mehr auf dem Appellplatz. Somit verhinderten die widerständigen Häftlinge die Evakuierung des ganzen Lagers und retteten 21.000 Häftlingen das Leben. Ab dem 10. April war bereits Artilleriefeuer zu hören, so dass die Alliierten nicht mehr weit sein konnten. Die SS-Männer fingen daraufhin an, ihre Flucht vorzubereiten. Am 11. April 1945 rannten viele von ihnen endgültig weg. Die Häftlinge bemächtigten sich der SS-Waffen und hissten um 15:15 Uhr eine weiße Fahne auf dem Tor. Der Befehl zum Aufstand war gegeben! Das nun offen auftretende antifaschistische Lagerkomitee und die militärische Leitung (IMO) übernahmen das Lager und sicherten es gegen noch drohende faschistische Angriffe. Die SS-Leute, die sich noch im Lager befanden, wurden von den – nun ehemaligen – Häftlingen gefangen genommen. Zudem machten sich Letztere in die umliegenden Wälder und Orte auf, um fliehende SS-Männer gefangen zu nehmen. So stieß eine Gruppe bis Klein-Obringen vor, wo sich eine SS-Siedlung befand, in der die Scharführer der Kommandantur wohnten. Die Siedlung hatten die Häftlinge errichten müssen. Bei der Durchsuchung fanden sie den Hauptscharführer aus der politischen Abteilung. Sieben weitere Kommandanturangehörige setzten sie in der weiteren Umgebung fest und steckten alle in den Bunker. Insgesamt konnten die IMO und andere politische Häftlinge 220 SS-Leute gefangen nehmen, die sie der am 13.4.1945 eintreffen US-Armee übergaben. Die AntifaschistInnen töteten und verletzten keinen einzigen der ehemaligen KZ-Wärter oder -Funktionäre.
Am 19. April 1945 traten die ehemaligen Häftlinge bei einer Trauerkundgebung auf dem Appellplatz des Lagers nach Nationalitäten geordnet an und schwuren: „Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.“
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln bleibt bis heute unser Ziel. Die PräsidentInnen aller internationalen Häftlingsverbände haben sich zum 27. Januar 2009, dem 64. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung, zusammengefunden und unter dem Titel „Erinnerung bewahren – authentische Orte erhalten – Verantwortung übernehmen“ ein gemeinsames Vermächtnis formuliert. Darin heißt es unter anderem: „Nach unserer Befreiung schworen wir, eine neue Welt des Friedens und der Freiheit aufzubauen: Wir haben uns engagiert, um eine Wiederkehr dieser unvergleichlichen Verbrechen zu verhindern. Zeitlebens haben wir Zeugnis abgelegt, zeitlebens waren wir darum bemüht, junge Menschen über unsere Erlebnisse und Erfahrungen und deren Ursachen zu informieren. Gerade deshalb schmerzt und empört es uns sehr, heute feststellen zu müssen: Die Welt hat zu wenig aus unserer Geschichte gelernt. (…) Unsere Reihen lichten sich. (…) Wir bitten die jungen Menschen, unseren Kampf gegen die Nazi-Ideologie und für eine gerechte, friedliche und tolerante Welt fortzuführen, eine Welt, in der Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus keinen Platz haben sollen. Dies sei unser Vermächtnis.“
Das indirekte „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“ des Schwurs von Buchenwald sehen die Überlebenden nicht umgesetzt. Der Aufruf dieser AntifaschistInnen gibt uns neben unseren eigenen gesellschaftspolitischen Erfahrungen und moralischen Standpunkten eine weitere historische Dimension der Legitimität antifaschistischen Kampfes.
Zum Weiterlesen
Revolution und bewaffnete Aufstände in Deutschland 1918 bis 1923. Von Langer, Bernd.
Wer die Hoffnung verliert, hat alles verloren. Kommunistischer Widerstand in Buchenwald. Von Peters, Ulrich.
Unter den Augen der SS. Otto Roth und der bewaffnete Aufstand im KZ Buchenwald. Von Roth, Arthur.
Der Tote mit meinem Namen. Von Semprún, Jorge.
Kreuzweg Ravensbrück. Lebensbilder antifaschistischer Widerstandskämpferinnen. Hrsg. von Jacobeit, Sigrid und Lieselotte Thoms-Heinrich.
Antifaschistische Biographien
Ernst Fischer
In Göttingen am Wohnhaus Neustadt 17 findet sich eine Gedenktafel: „Ernst Fischer, geboren am 8.6.1915 in Göttingen. Hingerichtet am 3.2.1940 in Berlin-Plötzensee“.
Da der Vater berufsbedingt mehrfach versetzt wird, lebt die Familie Fischer zeitweilig in Stolberg bei Aachen. Vater und Mutter sind beide Mitglieder der SPD und der Gewerkschaft, die Mutter Friederike Fischer ist später zudem bei der Arbeiterwohlfahrt aktiv. 1911 wird die erste Tochter geboren, 1913 kommt das zweite Kind Else zur Welt. Der Vater stirbt 1915 vermutlich im Ersten Weltkrieg. Im selben Jahr geht die Mutter mit den Kindern zurück nach Göttingen, hier wird am 8.6.1915 Ernst Fischer geboren. Sie wohnt mit den drei Kindern zunächst in der Wendenstraße 7 und zieht später in die Neustadt 23, das später die Hausnr. 17 erhält. Friederike Fischer „malocht“ in Göttingen täglich 8 Stunden im Lager der Firma Ruhstrat. Die Firma Haustechnik-Schaltanlagen Adolf Ruhstrat mit Sitz in der Adolf-Hoyer-Str. 6 in Göttingen gilt als NSDAP-freundliches Unternehmen. Während Friederike Fischer das Geld verdient, nimmt die Großmutter die 3 Kinder zu sich und zieht sie groß. Um 1923 heiratet Friederike Fischer erneut, aus der zweiten Ehe gehen jedoch keine weiteren Kinder hervor.
Bei der Firma Adolf Ruhstrat macht auch Ernst Fischer eine Berufsausbildung zum Feinmechaniker. Er ist Mitglied im Kommunistischen Jugendverband (KJVD) und im antifaschistischen Widerstand aktiv. Er stellt auch nach 1933 illegale Schriften her und vertreibt diese, so fällt er 1934 den Behörden als Verteiler des kommunistischen Jugendblatts „Junge Garde“ im Saarland auf.
Doch schon bevor die Nazis die Macht übertragen bekommen, gerät Fischer mit dem Staat in Konflikt. Seit dem 6.12.1932 sitzt er in der Erziehungsanstalt in Hannover-Laatzen Kronsberg ein. 1934 wird er in einem Bericht des Göttinger Staatsanwalts vom 19.12.1934 als „übelbeleumundeter Mensch, der bereits in jungen Jahren Diebstähle ausführte und bis zur nationalen Erhebung der kommunistischen Jugend angehörte“ benannt. Seit dem 5.3.1935 wird er im Jugendgefängnis Neumünster festgehalten.
Schließlich arbeitet Ernst Fischer als Matrose in Kiel. 1938 muss er seinen Wehrdienst bei der Kriegsmarine abgelten. Im selben Jahr wird er das letzte Mal in Göttingen gesehen. Am 21.12.1939 wird Ernst Fischer vom Reichskriegsgericht wegen „Fahnenflucht und Landesverrat zum Tode und zu 2 Jahren Gefängnis“ verurteilt. Vermutlich desertierte er von der Wehrmacht, um sich nicht am faschistischen Angriffskrieg zu beteiligen. Am 3.2.1940 wird er im Alter von 25 Jahren in Plötzensee geköpft. In der Nazi-Hinrichtungsstätte werden während des Faschismus 2915 politische GegnerInnen aber auch Militärangehörige, denen kriminelle Delikte vorgeworfen werden, ermordet. Fischer ist im Plötzensee-Gedenkbuch namentlich aufgeführt.
Seine Schwester Else bewegt sich im Umfeld des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds (ISK) und arbeitet bis 1933 im Kindergarten des Freidenker-Verbands in Göttingen. Sie heiratet Otto Wagner, wird nach der Befreiung vom Faschismus SPD-Mitglied, ist bei den Naturfreunden aktiv und arbeitet bei der AWO. In einem Zeitzeugeninterview erinnert sich der Kommunist Willi Rohrig: „Ich weiß noch wie ich aus der Gefangenschaft gekommen bin. Wie die Else Wagner auf Antikommunismus gemacht hat. Da habe ich mit den Ohren geschlackert und der Otto war doch früher KJV gewesen“. Else Wagner selbst zeigt sich von der Initiative des DKP-Ratsherrn Reinhard Neubauer für eine Straßenbenennung nach ihrem Bruder Ernst Fischer wenig angetan. Ihre Mutter habe sich aus Sorge vor Nachteilen für die Schwiegersöhne der Familie nicht mit der Geschichte ihres Ss beschäftigen wollen. Else Wagner: „Das bringt die nur in Deibels-Küche, wenn wir da jetzt was anrühren, da muss man sich mit abfinden. Die Mutter hat sehr darunter gelitten aber nie was dazu gesagt. Kurz bevor sie starb hat sie alle Unterlagen, wie’s Telegramm aus Plötzensee (…) zerrissen. (…) Egal“. Und weiter: „Und die wühlen das jetzt wieder auf. Ich war nicht so sehr begeistert. Ha’m s’e da innen Rat gebracht. 40 Jahre nach Kriegszeit und so weiter. Ha’m sich dazu durchgerungen, dass sie ihm an seinem Wohnhaus eine Tafel widmen wollen. Na ja, davon ha’m wir ihn auch nicht wieder, der wäre jetzt 71 geworden.“
Der Antrag für eine Würdigung Ernst Fischers wurde am 1.3.1985 von Reinhard Neubauer im Namen auch der Fraktionen der SPD, GLG und Agil in den Rat der Stadt Göttingen eingebracht und zunächst an den Kulturausschuss verwiesen. Die Umstände, dass die Leiterin des Stadtarchivs trotz aufwändiger Recherchen nur wenige Informationen über Ernst Fischers Leben zusammentragen kann, der Beigeschmack seiner „kriminellen Karriere“ und vermutlich die Aufforderung, einem Kommunisten gedenken zu sollen, färbt die Diskussionen mit einem problematisierenden Unterton ein. Der Kontrast wird angesichts einer Gedenkinitiative der anderen Art deutlich: Als die SPD 1963 einen Gedenkstein zum 20. Jahrestag des Hitler-Attentats am 20. Juli am Stauffenbergring beantragt, kann dieser einvernehmlich beschlossen und zügig verwirklicht werden. Auch wenn jeder regionale Bezug zum 20. Juli in Göttingen fehlt, so soll der militärische und kaum demokratisch motivierte Widerstand gegen Hitler dem gegenwärtigen nationalen Bewusstsein zuträglich sein. Auch die Gedenktafel für Ernst Fischer kann schließlich am 10.6.1986 eingeweiht werden. Auf ihr fehlt jedoch jeder Hinweis, dass es sich bei ihm um einen Kommunisten und Antifaschisten handelte. Um diesen Teil der Widerstandsgeschichte gegen den deutschen Faschismus muss in Göttingen weiter gerungen werden.
Lieschen Vogel
Auf dem obenstehenden Foto schauen uns fröhliche und optimistische junge AntifaschistInnen aus Göttingen entgegen. Das Foto wurde von Heinrich „Hanko“ Meyer, dem Sohn der Göttinger KommunistInnen Louise und Karl Meyer, aufgenommen. Vermutlich bildet es einen Landeinsatz, also eine kommunistische Agitation in ländlichen Regionen, ab. Zwei der jungen Menschen tragen den Aufnäher der historischen „Antifaschistischen Aktion“, die 1932 gegen den drohenden Faschismus gegründet wurde. Die junge Frau mit dem Aufnäher ist Lieschen Vogel. Sie trägt eine Krawatte, was damals einige Kommunistinnen getan haben, um eine moderne und emanzipierte Haltung auszudrücken. Lieschen Vogel war in Göttingen Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands Deutschlands (KJVD) und später der Kommunistischen Partei (KPD). Als junge dynamische und kraftvolle Frau aus der Göttinger KPD war ihr Foto für uns sogleich faszinierend und stellte den Ausgangspunkt für unsere vielfältigen Recherchen zur Göttinger ArbeiterInnengeschichte dar.
Elisabeth Anna Vogel wird am 24. Mai 1906 in Berlin Wilmersdorf als zweites Kind des Arbeiters Heinrich Vogel und seiner Frau Martha, geb. John, geboren. Das erste Kind lebt vermutlich nicht lange. Nach achtjährigem Besuch der Volksschule fängt Lieschen Vogel mit 14 Jahren an, überwiegend als Näherin zu arbeiten. 1922 beginnt mit 16 Jahren ihre bis zum Lebensende andauernde politische Biographie, indem sie in Berlin den Roten Naturfreunden beitritt. 1923 zieht die 17-jährige Lieschen Vogel mit ihrer Mutter nach Göttingen, da diese nach dem Tod ihres Mannes dann Heinrich Kistner aus Göttingen heiratet. Lieschen Vogels Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen – viele junge Menschen dieser Zeit wachsen wie sie Väter auf. Die Wiederheirat der Mutter erklärt sich unter anderem aus den Umständen dieser Zeit: Anfang der 1920er Jahre ist der politische Berliner Alltag vom Bewusstsein über mordende Freicorps geprägt, die Inflation grassiert, die Versorgungslage ist äußerst schwierig. Vermutlich heiratete die Mutter Heinrich Kistner aus dieser Not und einem halbwegs sicheren sozialen Status heraus, denn nicht nur sie selbst, sondern auch Kistner sind zu dieser Zeit verwitwet.
Kistner ist Schaffner und wohnt in Göttingen im alten Eisenbahnerviertel in der Breymannstr. 3, wo von nun an auch Lieschen und ihre Mutter leben. In Göttingen wird Lieschen Vogel 1923 Mitglied des KJVD und leitet zweieinhalb Jahre den Jung-Spartakusbund. 1929 tritt sie der KPD bei und ist bis zum Parteiverbot 1933 im Literaturvertrieb und im Landeinsatz aktiv. Bis August 1933 verteilt sie zudem Flugblätter und kassiert illegal für die Partei. Am 9. August 1933 wird sie nach dreimaliger Hausdurchsuchung von der Polizei verhaftet und am 23. August 1933 nach vierzehn Tagen Polizeigefängnis als „KPD-Funktionärin“ gemeinsam mit der Göttinger Genossin Else Heinemann ins KZ Moringen in der Nähe Göttingens verschleppt. Am selben Tag wird auch der Göttinger KPDler Gustav Kuhn im KZ Moringen eingeliefert. Die drei sind in diesem Zeitraum die einzigen Göttinger AntifaschistInnen, die in ein KZ gebracht werden. Zu jener relativ frühen Zeit werden nur die wenigsten politisch Aktiven in Konzentrationslager verschleppt. Nur klassifizierte „FunktionärInnen“ sollten in die noch relativ wenigen KZs eingeliefert werden. In Moringen gehören sie zu den ersten Häftlingen überhaupt, einen Tag vor ihnen waren gerade vier Kommunistinnen eingeliefert worden. Lieschen Vogel schreibt 1986 über ihre Zeit im KZ Moringen: „Es gab bei Verstoß gegen die Lagerordnung harte Strafen gefürchtet war der Dunkelarrest das hies, Decke, Essen nur jeden dritten Tag, sonst nur Wasser. Oft wurde auch das Lager gefilzt das bedeutet mit den Sachen auf den Lagerplatz dann wurde die Unterkunft auf Schriften untersucht anschließend Leibesvisite bei entblößten Körper. Zur Arbeit wurden wir nicht eingesetzt.“ Nach einer sogenannten „Weihnachtsamnestie“ werden Lieschen Vogel und Else Heinemann am 24. Dezember 1933 wieder entlassen. Nachdem KZ-Häftlinge bereits zur Reichstagswahl und Volksabstimmung am 12. November 1933 mit Versprechungen und großem Druck zur Wahl gezwungen wurden, veranlasste Hitler diese „Amnestie“, um unter und gegen AntifaschistInnen massive Bedrohung zu verbreiten.
Nach ihrer Freilassung gehen Lieschen Vogel und Else Heinemann zurück nach Göttingen. Lieschen Vogel zieht wieder zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in die Breymannstraße. Sie schrieb 1986 über sich selbst, dass sie zu jener Zeit „sehr bekannt war“ und ihr deshalb keine weitere politische Aktivität in Göttingen mehr möglich war, außer dem Abhören von Rundfunksendern außerhalb Göttingens. 1935/36 stellt sie zudem zwischen der illegal arbeitenden Berliner KPD und Göttinger Genossen wie Willi „Fibs“ Rohrig Kontakte her.
Nachdem Kistner 1939 im Alter von 75 Jahren stirbt, ziehen Lieschen Vogel und ihre Mutter 1941 wieder nach Berlin. Sie wn erst im alten ArbeiterInnenviertel in Berlin-Charlottenburg, bei Georg Vogel in der Kantstr. 128. Lieschen Vogel arbeitet als Wirtschafterin bei einer Verwandten. 1943 stirbt ihre Mutter, 1944 zieht sie nach Wilmersdorf in die Gasteiner Str. 30, in die Berliner Str. 37 und in die Mainzer Str. 16. Von Mitte 1945 bis Mai 1946 arbeitet sie in Wilmersdorf im Volkshaus in der Kaiserallee 187 (heute Bundesallee), das ab 1946 zur SED-Einrichtung „Genossenschaft Volkshaus Wilmersdorf für Kunst und Volksbildung” wird und Lieschen Vogel damit einen politischen Arbeitsplatz bietet. Als Gastdelegierte der KPD nimmt sie auf dem Vereinigungsparteitag am 21./22. April 1946 in Berlin teil, auf dem KPD und SPD zur SED zusammengeschlossen werden.
Nach ihrer Arbeit im Volkshaus fängt sie Mitte 1946 als Maschinenarbeiterin in der Delbag Berlin-Halensee in der Schweidnitzer Straße 11-15 an. Dort lernt sie Kurt Eichler kennen, heiratet ihn 1948 und zieht zu ihm in die SBZ nach Berlin-Friedrichshain. In jenem Jahr tritt Eichler in die SED ein und arbeitet von 1953 bis 1964 als Bürgermeister in den Berliner Vororten Rehfelde und Münchehofe/Strausberg sowie als Standesbeamte in Rehfelde. 1964 ziehen sie wieder nach Berlin und leben in Berlin-Mitte in der Neuen Jakobstr. 5. Im Laufe der folgenden Jahre ließen sich Vogel und Eichler wieder scheiden. Lieschen Vogel zieht 1970 in Berlin-Mitte in die Brückenstr. 12, fünf Jahre später im selben Stadtteil in die Inselstr. 11.
In der DDR war Lieschen Vogel als Organisationsleiterin der Wohngebietsparteiorganisation, der Betriebsparteienorganisation und der Handelsorganisation aktiv. 1968 ist sie Zehnerkassierin im Demokratischen Frauenbund. Mit diesen Aufgaben ist sie wie schon seit Anfang der 1920er Jahre an der sozialen Basis aktiv. 1968 stellt sie mit 62 Jahren bei der Kreiskommission der Verfolgten des Naziregimes (VdN) in der DDR einen Antrag auf Aufnahme. Dieser wird mit der Begründung abgelehnt, dass nach ihrer Entlassung aus dem KZ Moringen „jede politische Tätigkeit“ fehle.
1984 versucht der Göttinger Kommunist Wolfgang Oehme wieder Kontakt zu Lieschen Vogel aufzunehmen. Zwei Jahre später stirbt sie am 29. Mai im Alter von 80 Jahren in Berlin-Friedrichshain, wo sie seit 1983 in der Liebensteiner Str. 45 lebte.
Regionale Geschichtsschreibung
Mit den Überlegungen zur Geschichtspolitik, Geschichtsvermittlung und Geschichtsschreibung nehmen wir uns nicht nur unserer Geschichte des antifaschistischen Widerstands im übergeordneten deutschen Kontext an. Unsere Fragen und Herangehensweisen erarbeiteten wir uns auch anhand regionalgeschichtlicher Ereignisse in Göttingen. Das offizielle Göttinger Stadtgedenken ist in Bezug auf antifaschistischen Widerstand entweder gar nicht oder aber militaristisch geprägt. Antifaschistische oder gar kommunistische Widerstandsgeschichte wird in der offiziellen Stadtgeschichte in der Regel am Rande abgehandelt oder aber problematisiert. Die alternative Stadtgeschichtsschreibung ist hingegen vom Bild geprägt, dass Göttingen eine Nazihochburg war, in der es Oppositionsbewegungen aus den Gewerkschaften und der SPD gab – und die KPD dabei kaum bis gar keine Rolle gespielt habe. Dieses gängige Bild wollen wir durch neue Erkenntnisse ergänzen und korrigieren und einen Beitrag für eine umfassendere Betrachtung liefern.
Deshalb recherchierten wir, indem wir verschiedene Stadt-, Landes-, Staats- und Bundesarchive kontaktierten oder aufsuchten und dort Polizei-, Entschädigungs- und Meldeakten durcharbeiteten. Wir kontaktierten den International Tracing Service (ITS) Bad Arolsen sowie verschiedene Gedenkstätten mit Rechercheanfragen. Wir wälzten in alten Adress- und Telefonbüchern. Wir führten Gespräche mit Menschen aus Göttinger kommunistischen Familien, suchten ehemalige Wohnorte in der BRD auf und führten dort Gespräche mit Menschen, die sich noch an Personen aus Göttingen erinnerten, wir analysierten historische Fotos und lasen sehr viel Literatur aus und über die damalige Zeit.
Als linksradikale Gruppe widmen wir uns besonders der Rolle von KommunistInnen in Göttingen und der Region, denn die KPD leistete unter den großen Parteien den konsequentesten Widerstand gegen den deutschen Faschismus und bezahlte dafür den höchsten Preis. Innerhalb einer verdrängenden Sichtweise auf den Faschismus „wir haben von allem nichts gewusst“ und „man konnte nichts dagegen tun“ hat die Möglichkeit, Widerstand zu leisten, zwangsläufig keinen Platz. Dem guten Gewissen der nationalen Geschichtsschreibung darf lediglich militaristischer (Stauffenberg) oder pazifistischer (Weiße Rose) Widerstand zuträglich sein. Kommunistischer und/oder bewaffneter Widerstand wird hingegen systematisch ausgeblendet.
Durch unsere eigenen Recherchen können wir eine politische Einschätzung v. a. über Anfang/Mitte der 1930er Jahre in Göttingen treffen, die das Bild der bisherigen Göttinger Stadtgeschichtsschreibung erweitert: in Göttingen gab es trotz der dominanten Rolle der NSDAP eine relativ starke KPD, gemessen an Mitgliederzahlen, Infrastruktur und Aktionsformen. Das heißt nicht, dass Göttingen ein Schwerpunkt der KPD gewesen wäre, wie etwa die ArbeiterInnenviertel in Berlin. Dennoch war die Relevanz der kommunistischen Partei für die politischen Auseinandersetzungen in der Stadt bemerkenswert. Nehmen wir die heutige Situation zum Vergleich, stellen wir fest, dass die radikale Linke gegenwärtig weder auf ganze Stadtviertel in Göttingen zurückgreifen kann, noch regelmäßig Veranstaltungen mit mehren hundert BesucherInnen oder Demonstrationen mit 1000 TeilnehmerInnen durchführt. Heute kann keine Partei, die offen den Kommunismus propagiert, ein Wahlergebnis von 9 % erzielen.
Fakten: Zahlen
In den 1930er Jahren war Göttingen erheblich kleiner als heute. Während die Stadt heute ca. 120.000 EinwrInnen zählt, waren es 1933 gut 47.000. Die äußeren Stadtteile Weende, Grone und Geismar gehörten noch nicht zur Stadt Göttingen, sondern wurden eigenständig verwaltet. Auf Grund der Stadt-Struktur gab es in Göttingen keine Industriezentren und damit kein Industrieproletariat, was für die KPD im Reich einen festen Mitgliederstamm ausmachte. Viele Arbeiter in Göttingen verdienten ihren Lohn beim Reichsbahnausbesserungswerk (RAW), dem Flughafen Grone oder dem Aluwerk Alcan. Das RAW war mit einer gewerkschaftlichen Organisierung von fast 90 % der Betrieb mit der höchsten Rate und galt für reaktionäre Kreise als „Krisenherd ersten Ranges“. Viele Arbeiterinnen verdienten ihr Geld zum Beispiel als Näherinnen. Auf Grund der schwierigen Arbeitsmarktsituation waren die ArbeiterInnen sehr mobil, indem sie in anderen Städten anheuerten. Spezielle Facharbeiter arbeiteten zudem bei Ruhstrat, Sartorius und Zeiss. Als mehrheitliche Partei der ungelernten ArbeiterInnen und Arbeitslosen konnte die KPD unter diesen Facharbeitern aber keine erwähnenswerten Mitgliederzahlen verzeichnen. Mit der „Roten Studentengruppe“, die 1931 laut Polizeiangaben ca. 10-15 Mitglieder zählte, gehörten nur wenige AkademikerInnen dem Kreis der KommunistInnen an. Allerdings gab es in Göttingen darüber hinaus einen kleinen Kreis von AkademikerInnen, die sich im Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK) organisiert hatten.
Die Stadt Göttingen war also weniger vom Industrieproletariat als vielmehr von Universität und Militär geprägt. Dementsprechend dominierten ein national-konservatives Bürgertum und Burschenschaften das Stadtbild. In der Konsequenz war Göttingen schon Ende der 1920er Jahre eine Hochburg der Faschisten. Die Wahlergebnisse der NSDAP lagen stets über dem Reichsdurchschnitt – zum Beispiel kam sie bei der Reichstagwahl vom 31.7.1932 auf 51 % der Stimmen gegenüber dem Durchschnitt von 37,4 %.
Unter diesen widrigen Umständen gab es in Göttingen dennoch antifaschistischen Widerstand. Die KPD konnte unter diesen Bedingungen statistisch gesehen eine relativ hohe AnhängerInnenschaft verzeichnen: Bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 bekam die Partei in Göttingen 2389 Stimmen, das waren 9,1 %. Die SPD erhielt mit 6201 Stimmen 23,6 % – so dass die beiden ArbeiterInnenparteien mit ihren 8590 Stimmen fast gleichbedeutend der NSDAP mit 9946 Stimmen (37,8 %) gegenüberstanden. Nichts desto trotz lagen die Wahlergebnisse der KPD in Göttingen immer, teilweise auch deutlich, unter dem Ergebnis im Reichsdurchschnitt.
Im Stadtbild befanden sich die kommunistischen Schwerpunkte in den drei Göttinger ArbeiterInnenvierteln: das Erste war das Eisenbahner-Viertel um Breymannstraße, Jahnstraße, Leinestraße, das der Göttinger Kommunist Willi Rohrig später in einem Interview als „Zentrum“ der KommunistInnen bezeichnete. Das zweite ArbeiterInnenviertel war das Johannisviertel/Neustadt um Papendiek, Petrosilienstraße und Neustadt. Das dritte war das Ebertal am Lönsweg, eine damalige Hüttensiedlung mit Gärten und Kleintierhaltung. In diesen drei Vierteln erreichten KPD und SPD bei der Kommunalwahl 1929 zusammen die Mehrheiten.
Neben den quantitativen Wahlergebnissen ist die Anzahl der aktiven KommunistInnen aufschlussreich. Die Zeitzeugin Karin Rohrig erinnert sich für die 1930er Jahre an „mehrere hundert“ AktivistInnen in der KPD und der ihr angeschlossenen Organisationen wie dem Roten Frauen- und Mädchenbund, dem Kampfbund gegen den Faschismus (KgF) oder der Revolutionären Gewerkschaftsopposition (RGO) in der Stadt und Umgebung Göttingens.
Mit der Vielzahl an kommunistischen Organisationen und ihren Mitgliedern waren auch die Veranstaltungen der KPD und ihrem Umfeld gut gefüllt: Ostern 1924 veranstaltete die kommunistische Jugend in Göttingen einen Jugend-Tag mit 300 Jugendlichen aus Niedersachsen. Die OrganisatorInnen kommentierten diese Zahl als „nicht sehr stark“. Ähnliche überregionale Jugendveranstaltungen fanden in Göttingen auch in den folgenden Jahren statt. Am 6.1.1920 veranstaltete die KPD eine Kundgebung mit 1000 TeilnehmerInnen. Die Antifaschistische Arbeiterabwehr (damalige Kurzform: „Antifa“) zählte im April 1931 300 Mitglieder. An einer Antifa-Kundgebung gegen die „Bluttat der Faschisten und die Hetze in der bürgerlichen Presse“ beteiligten sich am 9.5.1930 1500 Menschen. Eine Diskussionsveranstaltung des KgF in den Göttinger Festsälen am Ritterplan zur Antifaschistischen Einheitsfront besuchten am 23.10.1931 knapp 300 Personen. Diese Großveranstaltungen lassen für Göttingen auf eine relativ starke Organisation und Infrastruktur schließen.
Linke Räume & Infrastruktur
Neben ihren ArbeiterInnenvierteln und ihrem politischen Ausdruck in Veranstaltungen und Demonstrationen, bauten sich die Göttinger KommunistInnen auch eine eigene Infrastruktur mit Finanzierung, Buchladen, Postfächern und Zugang zum städtischen Jugendheim auf.
Für die Umsetzung ihrer politischen Arbeit benötigte die KPD Geld. Verschiedene KassiererInnen warben Spenden für den antifaschistischen Kampffond in Buchläden ein, bspw. beim Buchhändler Hans Leicher. Eine kommunistische Buchhandlung befand sich bis vermutlich 1933 in der damaligen Goetheallee 3.
Ein Kassierer der Partei war ein Mann Namens Wagner, wohnhaft Neustadt 12. Bei einer Hausdurchsuchung am 23.11.1923 wurden bei ihm 251.220.066 (Zweihunderteinundfünfzig Millionen zweihundertzwanzigtausend sechsundsechzig) Mark als Kassenbestand der KPD beschlagnahmt. Während jener starken Inflationszeit bekam man dafür allerdings nicht mal einen Liter Milch.
Neben der politischen Arbeit der KPD musste auch die Arbeit der Roten Hilfe als Massenorganisation zur Freilassung der politischen Gefangenen im Umfeld der KPD finanziert werden. Viele KommunistInnen in Göttingen waren Mitglied in der Roten Hilfe. Immer drei KassierInnen waren hier verantwortlich für die Finanzen.
Die Göttinger KommunistInnen arbeiteten eng mit GenossInnen aus Hann.-Münden und Bad Lauterberg zusammen. Im Gegensatz zu Göttingen galten diese Orte als „rote Hochburgen“. Ihre Kommunikation hielten einige GenossInnen über Postfächer aufrecht: So soll die Landwirtin Ina Koelbel aus Bad Lauterberg (in Göttingen gemeldet Söhlwiese 4) laut Polizeiakten im Mai 1933 bahnpostlagernd, das heißt per Schließfach im Bahnhof, illegale Post nach Göttingen empfangen haben.
Die KPD hatte in Göttingen bis nach 1945 keine eigenen Büros und Veranstaltungsräume. Im Göttinger „Volksheim“ im Maschmühlenweg, dem Haus von Gewerkschaften und SPD, hatte die KPD ab November 1929 Veranstaltungsverbot erhalten. Treffpunkte waren ab dann wohlgesonnene Kneipen oder Privatwohnungen. Die kommunistische Jugend konnte auf die Struktur des städtischen Jugendheims zurückgreifen. Das damalige Jugendzentrum im heutigen Gebäude des Jungen Theaters/KAZ wurde von vielen verschiedenen Jugendgruppen genutzt, u. a. von der Naturfreunde-Jugend und dem KJVD (Kommunistischer Jugendverband Deutschlands). Willi Rohrig berichtete 1986: „Wenn wir Feierabend gehabt haben, dann sind wir nach Hause gegangen und haben uns gewaschen und dann natürlich ins Jugendheim. Wir hatten zwei Mal in der Woche Gruppenabend. Im Göttinger Jugendheim hat sich unser ganzes Jugendleben abgespielt, mit Volkstanz und Lieder singen und natürlich auch die politische Arbeit.“ Ihm rettete das linkspolitische Umfeld des Jugendheims die Haut, als er am 11. oder 12.1.1932 von Nazischlägern angegriffen wurde: „Wo jetzt die städtische Sparkasse drin ist am Markt, da gab es so ‘nen Eckeingang. Die [Hitlerjungen] kamen schon von der anderen Seite mit ihren Kanonenstiefeln an. Da hatten sie mich entdeckt und mir blieb nichts anderes übrig, als da in den Hauseingang, um den Rücken freizuhaben. Da habe ich anständig Senge bezogen. Und meine Frau die musste nun zugucken. (…) Dann sind sie noch hinterher gelaufen bis auf die Ecke wo es reingeht in die Kurze Straße, [die zum Jugendheim führte]. Den Durchgang gab es ja noch nicht, man musste immer beim Parkhaus da hinten rum, da hat sich kein Hitlerjunge mehr hin getraut.“
„Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!“
Neben Zahlen und Infrastruktur ist zur Einordnung der KommunistInnen auch die Frage nach der Qualität des Widerstands unter den widrigen Göttinger Umständen von Bedeutung. Angesichts der Konfrontationen mit Nazis und der Polizei haben sich bis 1933 in vielen Städten KommunistInnen zum Selbstschutz bewaffnet – so auch in Göttingen. Damit standen sie im Konflikt mit der KPD-Führung, die aus Angst vor Verboten und der Strategie von Massenmobilisierungen folgend, die individuellen Bewaffnungen an der Basis als „Einzelterror“ zu delegitimieren versuchte. Auch in Göttingen verlief die Ausrüstung mit Waffen eher individuell, denn als strukturiertes Kampfmittel. Die Waffen wurden v. a. zur Verteidigung eigener linker Orte und Strukturen genutzt, weniger zum aktiven Angriff. Anders als in den ArbeiterInnenvierteln im Ruhrgebiet oder in Berlin gab es in Göttingen keine toten Nazis durch AntifaschistInnen.
Die Waffen haben die Göttinger KommunistInnen bspw. in einer Kaserne in Hann.-Münden zu besorgen versucht. Laut Polizeibericht fragten der Hann-Mündener Karl Thies und die Göttinger Arno Deutelmoser und Heinz Klapproth – Letzterer lief später zu den Nazis über – am 12.4.1931 den Oberschützen Herrmann Seigocki, ob er aus seinem Infanterieregiment in Hann.-Münden Pistolen für die KPD bzw. einen Wachs- oder Seifenabdruck für den Munitionsschrank-Schlüssel besorgen könnte. Seigocki verriet die Kommunisten in Göttingen bei seinem Kompaniechef Stuppi, woraufhin sie am 5.9.1931 verhaftet wurden. Andere Soldaten, ein Hauptwachtmeister und zwei Anwärter der Polizeischule Hann.-Münden waren hingegen für die KPD aktiv.
Wie die Waffen in Göttingen verwahrt wurden, wird aus einer Anklageschrift vom 3.8.1937 deutlich: Der im März 1933 für die KPD ins Bürgervorsteher-Kollegium gewählte Adolf Reinecke und der KgF-Leiter Gustav Kuhn kamen im April/Mai 1933 zusammen, um Gewehre sicherzustellen. Die Waffen waren bei einer Versammlung im Herbst 1932 zusammengekommen. Gemeinsam mit dem KPDler Gustav Weiss versteckten sie die Waffen auf dem „Kleinen Hagen“, vermutlich dort, wo die Naturfreunde 1913 ihre erste Hütte bauten und bis heute ansässig sind. Einige Tage später versteckten sie die Waffen in einer Kiste, die Kuhn von 5 RM aus seiner Rote-Hilfe-Kassierertätigkeit übrig hatte, im Garten von Weiss. Die Kiste wurde später von der Polizei ausgegraben und 1937 beschlagnahmt. Reinecke wurde dafür zu 3,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Anschließend wurde er bis 1945 ins KZ Sachsenhausen verschleppt. Kuhn wurde zu 1,5 Jahren Zuchthaus verurteilt und danach bis 1945 im KZ Dachau eingesperrt.
In der Nacht vom 1. auf den 2.5.1933 wurden zwei SA-Männer in der Nähe des „Volksheims“ mit Pistolen beschossen. Das „Volksheim“ fungierte mit seinem Saal, seiner Kneipe und seinem Garten als Treffpunkt für antifaschistische Gruppen und diente oft als Auftaktort für Demonstrationen. Aus einer Demonstration von KPD, Reichsbanner und Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) am 2.7.1932 wurde zudem ein Polizist beschossen. Nachdem das Ziel verfehlt wurde, wurde der Polizist mit Revolverkolben verprügelt. Bei derselben Demonstration wurde am Weender Tor ein NSDAP-Mitglied unter Zuhilfenahme von Musikinstrumenten der begleitenden Schalmeien-Kapelle verprügelt. Andere Nazis wurden unter den Rufen „Nieder mit den Hunden!“ verjagt. Das Göttinger Tageblatt wütete am 4.7.1932: „Bürgerkrieg“.
Nach diesen Rahmungen zur Größe, zum Organisierungs- und Mobilisierungsgrad sowie zur Qualität des kommunistischen Widerstands in Göttingen wollen wir nun inhaltliche Stoßrichtungen vorstellen: Die Politik um die Einheitsfront/Antifaschistische Aktion sowie zu Veränderungen antifaschistischer Politik vor und nach der „Schutzhaft“-Welle im Jahr 1933.
Einheitsfront in Göttingen
In Göttingen bestand schon recht früh die Notwendigkeit, antifaschistische Selbsthilfe zu organisieren, um sich gegen rechte Burschenschafter, Deutschnationale und Faschisten zur Wehr zu setzen. ArbeitersportlerInnen, Roter Frontkämpferbund (RFB, Wehrgruppe der KPD), Reichsbanner (Wehrgruppe der SPD), Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK) und Einzelpersonen schützten politische Veranstaltungen wie Kundgebungen zum Ersten Mai.
Am 9.5.1930 wurde die Antifaschistische Arbeiterabwehr („Antifa“) in Göttingen auf einer Demonstration gegründet. Der Anlass zu diesem Schritt war u. a., dass die Faschisten in Göttingen immer gewaltbereiter gegen die ArbeiterInnen vorgingen. Darüber hinaus versuchte die bürgerliche Presse, allen voran das „Göttinger Tageblatt“, mittels Hetzartikeln gezielt einzelne Teile der Göttinger ArbeiterInnenschaft zu kriminalisieren. Die „Neue Arbeiter-Zeitung“ berichtete in ihrer Ausgabe vom 11.5.1930 unter der Überschrift „Arbeiterabwehr in Göttingen, Machtvoller Aufmarsch gegen den Faschismus“, dass die Göttinger ArbeiterInnen es sehr begrüßten, dass sie die erste antifaschistische Arbeiterabwehr in Südniedersachsen gegründet haben. 1500 Menschen befanden sich auf der Demonstration und hießen die Arbeiterabwehr mit dem verbotenen Kampfruf des RFB „Rot Front!“ willkommen. In ihrem Gründungsaufruf gingen sie auf die Notwendigkeit einer geschlossenen Arbeiterabwehr ein, um so den brutaler auftretenden Nazis die Stirn bieten zu können. Noch während der Demonstration sind ihr 60 Menschen beigetreten.
Die Staatsmacht reagierte mit Repression, so fanden bereits einen Tag später, am 10.5.1930, mehrere Hausdurchsuchungen mit 4 Verhaftungen statt. Der Zweck der Polizeitaktik war vermutlich die neugegründete „Antifa“ bereits in ihrer Entstehungsphase zu kriminalisieren.
Im September 1930 schätzte die Polizei Göttingens die „Antifa“, die unter dem Vorsitzenden Fritz Schaper geleitet wurde, auf etwa 100 Personen. Schaper hatte in der Vergangenheit verschiedene Demonstrationen für die KPD angemeldet und trat als Redner bei Veranstaltungen auf. Neben Fritz Schaper war Oskar Knodt in der Führungsspitze der „Antifa“ organisiert. Dieser stellte seine Wohnung für politische und konspirative Treffen zur Verfügung, organisierte Demonstrationen und Versammlungen des RFB und trat als Redner bei Umzügen oder Veranstaltungen auf.
Ab September 1930 veränderte die „Antifa“ ihr äußeres Erscheinungsbild und trat nun bei öffentlichen Veranstaltungen in einer eigenen Uniform und mit einer Schalmeienkapelle auf. Das Tragen der Uniform (blaue Mütze; blaue Bluse; ovales rotes Ärmelabzeichen mit Hammer, Sichel und Schwert sowie Koppel mit Sowjetzeichen) führte immer öfter zu Auseinandersetzungen mit Andersgesinnten. Aus Gründen der „öffentlichen Sicherheit“ versuchte die politische Polizei Göttingens, die entsprechenden Stellen immer wieder zu kontaktieren und sie für einen Verbotsantrag der Antifaschistischen Arbeiterabwehr zu gewinnen. Dieser konnte jedoch bis 1933 nicht durchgesetzt werden. Am 24.2.1931 wurde Fritz Schaper von der Polizei verhaftet und später vor Gericht gestellt. Wegen „Aufruhrs“ wurde er zu 2 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Zu dieser Zeit zählte die Antifa laut Polizeiangaben bereits 300 Mitglieder.
Anfang Januar 1931 kam es durch interne Richtungskämpfe zu einer Abspaltung in der „Antifaschistischen Arbeiterabwehr“, woraufhin der KPDler Gustav Kuhn eine Göttinger Ortsgruppe des Kampfbunds gegen den Faschismus (KgF) gründete. Der KgF hatte laut damaligen Polizeiangaben anfangs eine Mitgliederstärke von 131 Personen, darunter neun Frauen. Mit bspw. einem „Propaganda-Umzug“ am 28.5.1931 versuchte der KgF eine Art Einheitsfront zu schaffen. Neben Demonstrationen wurden auch Versammlungen und Kundgebungen abgehalten, wie unter anderem am 29. Mai 1931 in den Göttinger Festsälen (Ritterplan) mit dem Titel „Anfang und Ende des Faschismus“. Fünf Monate später, am 24. Oktober 1931, veranstaltete der KgF erneut in den Göttinger Festsälen eine öffentliche Zusammenkunft mit dem Thema „Faschismus“. Die Referenten waren die KPDler Gmeiner aus Braunschweig und Gustav Kuhn. Die Veranstaltung wurde laut Polizeiangaben von 280 TeilnehmerInnen mit überwiegend KommunistInnen und SozialdemokratInnen gut besucht. Die VeranstalterInnen hatten zudem auch einige Faschisten eingeladen, diese sollten Stellung zu den Vorkommnissen in Braunschweig nehmen: Dort versuchten am 18. Oktober 1931 über 40.000 NSDAP-Mitglieder in die Stadt einzumarschieren. Jedoch sei den Nazis der Einmarsch laut dem KPD-Referenten aus Braunschweig in keiner Straße gelungen. Nur vereinzelt seien Arbeiter von Nazis überfallen worden. Die Faschisten in der Göttinger Veranstaltung gaben sich auf die Frage, ob sie anwesend seien und zu den Vorfällen nun Stellung nehmen wollten, nicht zu erkennen. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung forderte Kuhn die Göttinger Arbeiterschaft immer wieder dazu auf, sich dem KgF anzuschließen, um auch in Göttingen eine schlagkräftige Einheitsfront bilden zu können.
Die Göttinger Polizei arbeitete hingegen daran, solch eine Einheitsfront zu verhindern und nahm dafür auch den Vorsitzenden des Kampfbunds gegen den Faschismus ins Visier. Gustav Kuhn wurde Ende des Jahres 1931 verhaftet und zu 2 Jahren Haft verurteilt. Hiermit hatte die Staatsmacht einen wichtigen Schlag gegen den KgF gesetzt. Die Strategie der Polizei schien aufzugehen, zwar bestand der KgF auch weiterhin, jedoch sank die Mitgliederzahl deutlich ab. So seien laut Polizeiangaben im Kampfbund gegen den Faschismus ab 1932 nur noch 60-70 Personen organisiert gewesen.
Letzte Aktionen
In den Jahren 1932/1933 kam es verstärkt zu Konfrontationen zwischen linker ArbeiterInnenschaft und Nazis. Dabei ging es um die Straßenhoheit in Göttingen. Die Angriffsziele der Nazis waren unter anderem das „Volksheim“ und die drei linken ArbeiterInnenviertel.
Nach einer NSDAP-Veranstaltung am 29.07.1932 versuchten mehrere Faschisten in das Eisenbahnerviertel einzudringen. Den BewrInnen, meist KommunistInnen, SozialdemokratInnen und GewerkschafterInnen, war die Veranstaltung der Nazis nicht entgangen und so bereiteten sie sich auf einen möglichen Angriff vor. Als die Nazis begannen, mehrere Menschen in der Leinestraße zu attackieren, wurden sie zunächst mit einem deftigen Steinhagel zurückgeschlagen. Nachdem sie abermals probierten in das Viertel einzudringen, wurden sie mit Knüppeln, Zaunlatten und anderen Schlagwerkzeugen aus der Eisenbahnstraße angegriffen und aus dem Viertel gedrängt. Die Polizei beruhigte die Lage schnell und die Nazis flüchteten in die Innenstadt. Die ArbeiterInnen wiederum versuchten im Leineviertel unterzutauchen, um sich so der anstehenden Repression zu entziehen. In den folgenden Tagen hetzte das Göttinger Tageblatt gegen die BewrInnen des Eisenbahnerviertels. Die Polizei befeuerte die Medienkampange, indem sie ihre Ermittlungen ausschließlich gegen die BewrInnen des ArbeiterInnenviertels richtete. Sie intensivierte dort für die nächsten 1,5 Monate ihren Streifendienst. Es war ihnen jedoch nicht möglich, die entsprechenden AntifaschistInnen ausfindig zu machen. Im Laufe des Jahres 1932 kam es zu einer Intensivierung der Angriffe durch die Faschisten.
Die geschlossene Einheitsfront wurde in vielen Fällen von den „kleineren“ Parteien wie der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) und Organisationen wie dem ISK gefordert. Ihre gesellschaftliche Analyse war viel zutreffender als die von SPD und KPD oder der freien Gewerkschaften. Der ISK Göttingen forderte 1932 den Aufbau einer ArbeiterInnenfront auf der parlamentarischen Ebene zwischen KPD und SPD. Auf der gesellschaftlichen Ebene sollten sich all diejenigen Gruppen, Organisationen, und Einzelpersonen zusammenschließen, die gewillt waren gemeinsam gegen deutschnationale und faschistische Bestrebungen vorzugehen. „Die Vernichtung aller persönlichen und politischen Freiheit in Deutschland steht unmittelbar bevor, wenn es nicht in letzter Minute gelingt, unbeschadet von Prinzipiengegensätzen alle Kräfte zusammenzufassen, die in der Ablehnung des Faschismus einig sind.“ Die Mitglieder des ISK Göttingen thematisierten in regelmäßigen Veranstaltungen im Volksheim die Schaffung einer breiten Einheitsfront. Gruppen wie sie vermochten es dennoch nicht, das breite antifaschistische Bündnis zu knüpfen.
Die letzte öffentliche und größere Aktion gegen Nazis in Göttingen fand am 30.01.1933 gegen die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler statt. Gegen 18 Uhr trafen sich nach Polizeiangaben ca. 180, nach Angaben des Göttinger Kommunisten Willi Rohrig allerdings über 1.000 Personen am Hirtenbrunnen. Die Polizei erlaubte der von der KPD organisierten Demonstration durch die Innenstadt zu laufen. Sie wurde jedoch immer wieder von SA- und HJ-Einheiten angegriffen. Die Demonstration wurde schließlich „zum Schutz ihrer TeilnehmerInnen“ durch die Polizei vorzeitig beendet.
Antifaschistischer Widerstand in Göttingen vor und nach 1933
Schon vor 1933 waren die KommunistInnen mit staatlicher Repression konfrontiert. Am 21.8.1931 wurde eine Demonstration der Roten Hilfe mit dem Hinweis verboten, dass alle Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie Umzüge aller Art im Stadtgebiet Göttingen auf Weiteres untersagt würden. Am Ostersonntag wurde eine Versammlung des Kampfbunds gegen den Faschismus im Volksheim von der Polizei aufgelöst, weil das Verteilen von kommunistischen Flugblättern bei vorherigen Veranstaltungen gegen die Notverordnung verstoßen habe. Solche Repressalien schlossen an Notverordnungen und Verbote von Organisationsstrukturen, wie das des Roten Frontkämpferbundes, an. In dieser Situation fanden auch in Göttingen Hausdurchsuchungen statt. Am 21.8.1932 durchsuchte die Polizei das Büro und die Buchhandlung des sog. „Internationalen Bundes der Opfer des Krieges und der Arbeit“ in der Johannisstraße 24 sowie die Privatwohnungen von Gustav Kuhn und sieben weiterer Kommunisten.
Konfrontiert mit dieser beständigen Repression des bürgerlichen Staates vor 1933 und unter dem Vorzeichen der „Sozialfaschismus-These“ traf die KPD grobe Fehleinschätzungen und unterschätzte die Gefahr des aufkommenden Faschismus. In einer Veranstaltung unter dem Titel „Anfang und Ende des Faschismus“, den die Göttinger Ortsgruppe des Kampfbunds gegen den Faschismus schon am 29.5.1931 organisierte, wird dieses deutlich. Der Braunschweiger Redner Gmeiner erklärte dort: „Wenn wir vom Anfang des Faschismus reden, so können wir sagen, daß dieser bereits Jahre lang besteht. (…) Wir können aber nicht genau festlegen, wann der Faschismus aufhört. Wir können uns nur die Entwicklung vor Augen führen und danach feststellen, daß der Faschismus bald am Ende angekommen ist.“ Angesichts der Entwicklung, die der deutsche Faschismus nach 1931 tatsächlich noch genommen hat, war diese Einschätzung für die antifaschistische Bewegung geradezu fatal.
Diese Fehleinschätzungen und das Unvermögen der Parteiführungen von KPD und SPD, sich auf die neue Situation einzustellen, führten dazu, dass der sehr wohl bestehende Handlungsraum in den ersten Wochen nach dem 30.1.1933 nicht genutzt wurde. Die antifaschistischen Strukturen funktionierten zum Zeitpunkt der Machtübertragung an die Nazis vorerst noch. So konnte auch in Göttingen am 30.1.1933 die bereits beschriebene Demonstration organisiert werden. Noch am 24.2.1933 wollte der ISK eine öffentliche Aussprache im kleinen Saal des Volksheims zum Thema „Wir organisieren die Einheitsfront“ stattfinden lassen. Solche öffentlich angekündigten Veranstaltungen waren nach dem Verbot der KPD und anderer linker Organisationen und deren Verfolgung nicht mehr weiteres möglich. Im Laufe des Jahres 1933 veränderte sich damit unter dem Druck der faschistischen Repression und Verfolgung die Qualität des antifaschistischen Widerstandes. Offene Konfrontationen oder sogar bewaffnete Aktionen lassen sich in den Quellen und Berichten nach Mai 1933 für Göttingen nicht mehr nachweisen.
Ab März 1933 traf auch in Göttingen die erste Welle der sogenannten Schutzhaft die antifaschistischen Organisationen. Von 111 Menschen ist uns bekannt, dass sie zur Zeit des deutschen Faschismus im Polizeigefängnis (Gotmarstraße 8) und teilweise auch im Gerichtsgefängnis (Obere Maschstraße 9) festgehalten wurden. Als nach der Kommunalwahl am 11.3.1933 das Bürgervorsteher-Kollegium am 7.4.1933 zusammenkommen sollte, wurden die 7 sozialdemokratischen Abgeordneten für diesen Tag verhaftet. Den gewählten KPD-Bürgervorsteher Adolf Reinecke traf es bereits früher, er wurde schon am 3.3.1933 festgenommen und zunächst bis zum 11.4.1933 festgehalten. Im Polizeigefängnis bewahrten viele KommunistInnen eine widerständige Haltung. So traten Adolf Reinecke, Gustav Kuhn und drei weitere Gefangene am 28.3.1933 in den Hungerstreik. In einem Beschwerde-Brief an die Polizei-Direktion begründete Kuhn, dass es zwei Tage zuvor zu einem Konflikt mit dem Polizei-Oberwachtmeister Dette gekommen sei. Dieser hatte drohend und provokant geäußert: „Wenn ihr ins Konzentrationslager kommt, da werden wir euch schon mürbe kriegen. Hier geht es euch zu gut, ihr fresst euch hier zu dick“. Zwischen dem 1.3. und 31.8.1933 wurden in Göttingen 80 Menschen festgenommen, darunter 4 Frauen. Von den 80 AntifaschistInnen wurden von der Polizei 37 der KPD und 6 der SPD zugeordnet, über die restlichen ist keine weitere Partei- oder Gruppenzugehörigkeit bekannt.
Ein offenes Agieren gegen die Nazis war nunmehr für die AntifaschistInnen immer mit der Drohung verbunden, dafür erneut ins Gefängnis gesteckt zu werden. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf ihre Aktivitäten. Während in Orten mit einer starken antifaschistischen Bewegung auch nach dem Sommer 1933 noch aktiver, teils militanter Widerstand geleistet wurde, war die offene politische Konfrontation in Göttingen nun nicht mehr derart möglich.
Eine Möglichkeit auf die Verfolgung zu reagieren war die Flucht. Der Leiter des ISK Willi Eichler emigrierte bereits im Frühjahr 1933 zunächst nach Paris und später nach London. Aus diesem Exil gelang in den ersten Jahren ein ständiger Kontakt mit Material- und Nachrichtenaustausch zu den zurückgebliebenen ISK-GenossInnen in Göttingen. Der kommunistische Buchhändler Hans Leicher tauchte von März bis September 1933 unter, indem er nach Grenzau (bei Koblenz) zu seiner Schwiegermutter flüchtete. So konnte er sich vorerst der drohenden Schutzhaft entziehen. Vermutlich wegen der fehlenden Perspektive stellte er sich aber im September selbst der Polizei und wurde mit seiner Frau Paula bis zum 29.9.1933 in Schutzhaft genommen.
Ab August 1933 verschärfte sich in Göttingen der Druck der politischen Verfolgung, der auf den AntifaschistInnen lastete, noch einmal. Die Faschisten begnügten sich jetzt nicht mehr damit, politische GegnerInnen für einige Wochen in Schutzhaft im Polizeigefängnis zu halten. Sie verfolgten nun expliziter die FunktionärInnen als wesentliche TrägerInnen des Widerstandes und versuchten diese mit ihrer Verschleppung in Konzentrationslager zu brechen. Am 23.8.1933 wurden in diesem Zusammenhang aus der Schutzhaft in Göttingen Else Heinemann, Elisabeth Vogel und Gustav Kuhn in das KZ Moringen verschleppt. Die drei wurden vier Monate später im Zuge einer „Weihnachtsamnestie“ entlassen. In den KZs machten die AntifaschistInnen die Erfahrung, ihren hasserfüllten Gegnern ausgeliefert zu sein. In einem heimlichen Brief an seine Frau Frieda schrieb Adolf Reinecke neun Jahre später aus dem KZ Sachsenhausen: „(…) am 2.5.1942 habe ich mich gewogen. Mein Gewicht Kleidung betrug 98 Pfund (…) nichts ist gestattet, das einzige was man hier darf und was gestattet ist, ist sterben“. Elisabeth Vogel erinnerte sich 1968, dass sie nach ihrer Inhaftierung im KZ Moringen wegen ihrer Bekanntheit in Göttingen nicht mehr aktiv sein konnte. Unter der permanenten, massiven Bedrohung war es für die AntifaschistInnen schon eine Gefahr, sich überhaupt in linken Zusammenhängen zu treffen und ein kommunistisches Selbstbewusstsein aufrecht zu erhalten. Die Menschen, die aus der Schutzhaft wieder entlassen wurden, wurden weiterhin von der Polizei beobachtet. In Polizeiakten von 1934/35 gibt es immer wieder den Vermerk, dass gegen ehemalige Schutzhäftlinge weiter der Verdacht der „politischen Umtriebe“ besteht.
Wer nicht in Schutzhaft war, hatte zudem mit einer Göttinger Gesellschaft zu kämpfen, die in hohem Grade in die Macht- und Gewaltpraktiken des Faschismus involviert war. Im Mai 1933 forderten Nazi-Studenten die Buchhandlungen auf, jüdische und marxistische Literatur für die bevorstehende Bücherverbrennung am 10.5.1933 bereit zu stellen. Dem wurde zwar nachgekommen, allerdings erinnerte sich die ehemalige Buchhändlerin K. im Februar 1984, dass in der Buchhandlung Deuerlich verschiedene Menschen individuell Bücher vor der Verbrennung bewahrten: „(…) jeder nahm noch irgendwas und sagte, ‚ach das verbrenne ich zu hause in meinem Ofen‘.“ Doch die Atmosphäre von Angst und Misstrauen war schnell weit fortgeschritten. So berichtet K. weiter, dass ein Buchhändler sie „mal denunziert“ hatte, weil bei Deuerlich ein Buch aus dem jüdischen Propyläenverlag im Schaufenster lag. Ein anderes Beispiel liefert das Schreiben der Kreisleitung der NSDAP an die Kriminalpolizei Göttingen. Darin wurden die KommunistInnen Hugo Dornieden und Else Heinemann wegen ihres sexuellen Verhältnisses denunziert. Die Nazis baten die Polizei darum, Dornieden „streng zu beobachten“, weil dieser „in seine Familie zurück“ gehöre. Am 28.5.1933 schrieb der NSDAP-Ortsgruppenleiter an die Polizeidirektion Göttingen, dass sich in der Leinestraße und der Eisenbahnstraße KommunistInnen aufhalten würden, die, „da sie arbeitslos sind, auf den Straßen herum [stehen] und politisieren“. Er forderte den Polizeidirektor Gnade auf, die KommunistInnen nach Moringen, also ins nahe gelegene KZ, zu bringen, „damit endlich in den beiden genannten Straßen Ruhe und Frieden eintritt.“ Zugleich richteten sich Repressionen gegen Familienangehörige von Inhaftierten: Luise „Lieschen“ Kuhn (geb. Wild), die Frau von Gustav Kuhn, fand während der Schutzhaft-Zeit ihres Mannes keine Arbeit, weil dies von der Gestapo verhindert wurde. Später wurde ihre Ehe auf Druck der Gestapo zwangsgeschieden.
Das veränderte gesellschaftliche Klima lässt sich auch daran erkennen, dass die Nazis in Göttingen in vormals linke Räume vordrangen. Nachdem die nun von Faschisten besetzte Verwaltung 1933 zahlreiche Personalwechsel in der Stadt vorgenommen hatte, zog 1934 die Geschäftsstelle der „HJ“ in das städtische Jugendheim ein. Zwar konnten die linken Jugendgruppen sich längst nicht mehr unter ihren Gruppennamen versammeln, die kommunistischen Jugendlichen trafen sich erst aber unter dem Deckmantel von „Volkstanzabenden“ weiterhin in ihrem angestammten Jugendzentrum, wie sich Willi Rohrig erinnerte. Schließlich wurden die Jugendlichen gänzlich aus ihrem bisherigen Treffpunkt verdrängt.
Ähnlich verhielten sich die Nazis in Bezug auf das Volksheim, das ein SA-Sturm am 26.4.1933 besetzte und in „Haus der Deutschen Arbeit“ umbenannte: Am 5./6. Mai 1933 zerrte die SA 6 Gewerkschafter und SPDler aus ihren Wohnungen, schleppte sie ins Volksheim und folterte sie dort schwer. Die Nazis fesselten sie und schlugen sie mit Ochsenziemern bis zur Bewusstlosigkeit. Erst 1947 wurden sieben der Täter für diesen Überfall verurteilt.
Das ISK-Haus im Nikolausberger Weg 67 wurde am 14./15.1933 von 40 Nazis, die sich als Hilfspolizisten ausgaben, durchsucht. Am 12.7.1933 wurde das Vermögen des ISK beschlagnahmt.
Ab 1934 war unter diesen Bedingungen nur noch sehr beschränkt politische Aktivität möglich. Allerdings hat auch die KPD in Göttingen versucht, sich im Untergrund zu organisieren. Von 1933 bis 1935 traf sich eine Gruppe von KommunistInnen regelmäßig in der Wohnung von August Pläp in der Paulinerstr. 5 und hörte verbotene Radiosender. Auf mit Schreibmaschine beschriebenen und verteilten Klebezetteln war außerdem zu lesen: „Achtung! Proletarier, kämpft für Freiheit und Recht, tretet aus der SA, kämpft in der Roten Arbeiterpartei Deutschland, Rot Front lebt, Heil Moskau“. Im August 1937 wurden deswegen sieben Menschen wegen verbotener kommunistischer Betätigung und Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt. Von den benannten ZeugInnen der Staatsanwaltschaft saßen bis auf Pläps NachbarInnen und den Polizisten alle selbst in Untersuchungshaft. Aus den Akten wird deutlich, dass sie sich fast alle gegenseitig beschuldigt haben, was unter anderem auf die damaligen Haftmethoden mit Erpressung und Folter verweist. Andererseits bildeten die KPDlerInnen Louise und Karl Meyer in diesem Verfahren die einzigen Ausnahmen, die ihre GenossInnen nicht verraten haben. Für die KommunistInnen bedeutete das Verfahren noch einmal jahrelange Haftstrafen, teilweise mit anschließender Verschleppung in das KZ-System.
Auch der ISK verbreitete weiterhin Flugzettel und Parolen in Göttingen. Vor dem 1.5.1934 druckten die AntifaschistInnen im Arbeitsraum Heinrich Dükers im Psychologischen Institut der Universität Flugblätter. Diese wurden in den Straßen verstreut, so dass die Menschen auf dem Weg zur Mai-Feier die Zettel fanden. Eine von zwei 5er Gruppen des ISK klebte unter einen Koffer einen Farbstempel. „Wenn wir damit auf die Straße gingen und den Koffer absetzten, blieb dann auf der Strecke das Farbbild Nieder mit Hitler“, so Düker rückblickend 1983.
Im März 1936 wurde ein Verfahren gegen 14 Menschen aus Südniedersachsen, hauptsächlich aus Göttingen, die Angehörige des ISK sein sollten, wegen „hochverräterischer Unternehmens“ geführt. Auch hier saß der einzige Belastungszeuge zeitgleich in Untersuchungshaft der Nazis, auch die anderen Aussagen wurden anscheinend von den Verfolgten erpresst. Im Januar 1936 wurden die 14 ISKlerInnen verhaftet und in die Gerichtsgefängnisse in Göttingen, Duderstadt und Hildesheim gesperrt. Fritz Körber (ISK) wurde nach Verbüßung seiner vierjährigen Haft ins KZ Börgermoor verschleppt. Nachdem er selbst bald wieder entlassen wurde, kam sein Sohn, ein überzeugter Pazifist, als Soldat an die Ostfront und kehrte nicht wieder zurück. Heinrich Oberdieck (ISK) kam nach 3,5-jähriger Haft in ein Strafbataillon und blieb verschollen.
Widerstand in Göttingen beschränkte sich in dieser Situation darauf, dem faschistischen Terror zu entgehen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, Kontakt zu anderen GenossInnen zu halten und sich über Perspektiven nach dem deutschen Faschismus auszutauschen. Prof. Dr. Heinrich Düker unterstützte untergetauchte Mitglieder des ISK mit Lebensmitteln und Geld. 1936 wurde er selber verhaftet und für 3 Jahre in der Strafanstalt Wolfenbüttel festgehalten. 1944 wurde Düker erneut denunziert und in das KZ Sachsenhausen verschleppt. In den Aluminium-Werken in Weende diskutierte eine Gruppe Sozialdemokraten um Fritz Schmalz (ISK) den Wiederaufbau freier Gewerkschaften. Diese hielt Kontakt zu einer Gruppe um den Kommunisten Hermann Fraatz im Reichsbahnausbesserungswerk sowie zu einer sozialdemokratischen Gruppe bei der Firma Feinprüf. ZeitzeugInnen geben ein Bild von praktischer Solidarität in dieser Zeit: Karin Rohrig erinnerte sich daran, dass ihre kommunistische Familie vom Jahresende 1944 bis zum Kriegsende den Göttinger Kommunisten Willi Eglinsky bei sich versteckte. Wilhelm Eglinsky war bereits vom 4.4.-15.4.1933 in polizeiliche Schutzhaft genommen worden und wurde später von den Nazis ins KZ verschleppt. Laut dem Zeitzeugen Reinhard Neubauer war Eglinksy im KZ Buchenwald gefangen und muss also von dort geflohen sein. Die Familie Meyer, aus der Karin Rohrig kommt, versteckte Eglinsky in der Scheune in ihrem damaligen Wohnort Bovenden. Die Kinder, so erinnerte sich Karin Rohrig, durften zu der Zeit nie die Scheune betreten. Mit einer so gut überlegten und umgesetzten Solidarität haben die Meyers Eglinksy das Leben gerettet. Und nicht nur ihm: Kurz vor Kriegsende, als die Faschisten zum sogenannten „Volkssturm“ aufriefen, sperrten die Frauen der Familie Meyer Hanko, den Sohn von Karl und Louise, bei sich zu Hause in die Würstchenkammer, um ihn so am Verlassen des Hauses zu hindern. Im „Volkssturm“ wäre auch sein Leben schwer in Gefahr gewesen.
Zwei Göttinger Antifaschisten wurden von den Nazis ermordet. Der sozialdemokratische Rote-Hilfe-Rechtsanwalt und jüdische Kämpfer gegen den Antisemitismus Walter Proskauer wurde am 12.3.1943 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Der jugendliche Kommunist Ernst Fischer wurde am 21.12.1939 zum Tod verurteilt und am 3.2.1940 in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee ermordet, indem ihn die Nazis geköpft haben.
Am 8.4.1945 befreite die US-Armee Göttingen vom deutschen Faschismus. Die Kommunistin und Antifaschistin Lieschen Vogel hatte bereits 1941 Göttingen verlassen und beteiligte sich in der Sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR am gesellschaftlichen Neuaufbau. Als Gastdelegierte der KPD besuchte sie 1946 den Vereinigungskongress von SPD und Kommunistischer Partei zur SED.
Viele Aktive aus dem ISK wandten sich abgestoßen durch den Stalinismus erneut der Sozialdemokratie zu und übernahmen hohe Funktionen in Gewerkschaften und der SPD. Der erste Oberbürgermeister Göttingens war Heinrich Düker. Fritz Schmalz wurde DGB-Vorsitzender in Göttingen.
Jene Antifaschisten, die nach ihrer Befreiung aus den KZs nach Göttingen zurückkehrten, waren zumeist von den Qualen und Torturen schwer gezeichnet. Adolf Reinecke wurde am 22./23.4.1945 von der Roten Armee aus dem KZ Sachsenhausen befreit. In seinem Haftentschädigungsbescheid wurde später vermerkt: „Er war 117 volle Monate seiner Freiheit beraubt“. Sein Genosse Gustav Kuhn hatte nahezu 12 Jahre in Gefängnissen und KZs verbracht. Menschen wie er waren unter den Göttinger KommunistInnen nach 1945 weiterhin präsent, nahmen aber eine eher zurückgezogene und beratende Rolle ein, so die Zeitzeugin Karin Rohrig.
Gemeinsam mit jüngeren GenossInnen machten sich die alten KommunistInnen erneut an die politische Arbeit in der KPD. Die Partei bezog zunächst ein Büro in der Groner Straße und später am Johanniskirchhof. In vielen gesellschaftlichen Bereichen sahen sie sich mit den personellen Kontinuitäten des Faschismus konfrontiert. Das KPD-Verbot im Jahr 1956 war der Höhepunkt eines neuen-alten Antikommunismus in der BRD.
Zum Weiterlesen/Quellen
Göttingen Gänseliesel. Hrsg. von Duwe, Kornelia, Carola Gottschalk und Marianne Koerner.
Bnsuppe und Klassenkampf: Das Volksheim. Hrsg. von Bons, Jo, et al.
Das Fest der Arbeit: Die Geschichte der Göttinger Maifeiern. Hrsg. von Birsl, Ursula et al.
Lnde Geschäfte. Die „Entjudung“ der Wirtschaft am Beispiel Göttingens. Bruns-Wüstefeld, Alex
Von der Würdigung des kommunistischen Widerstands in Göttingen. Von Bolle, R. In: Gottschalk, Carola: Verewigt und vergessen.
Kampf dem Faschismus. Von Wimmer, Ruth und Walter
Auswahl Archiv-Quellen. Stadtarchiv Göttingen: Pol.Dir.Fach31aNr.2Bd.1 | Pol.Dir.Fach155 | Pol.Dir.Fach155Nr.1a | Pol.Dir.Fach155Nr.4 | PolDir.XXVIIFach159Nr.4AbE | PolDir.XXVIIFach155Nr.10 | Diverse Meldekarten | Hauptstaatsarchiv Hannover Nds. 110 W Acc. 31/99 Nr. 202328 | Landesarchiv Berlin: C. Rep. 118-01 – Hauptausschusss Opfer des Faschismus (OdF)/Referat Verfolgte des Naziregimes (VdN), Nr. 27106 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) Berlin: Melderegisterauszug E. Vogel
Antifaschistische Biographien
Gustav Kuhn
Gustav Albert Kuhn wird am 13.2.1892 in Königsberg geboren. 1906 verlässt er als 14-jähriger Jugendlicher die Schule und arbeitet danach in einem Schlachtereibetrieb.
1914 wird Gustav Kuhn als Matrose zum Ersten Weltkrieg einberufen. Doch schon im selben Kriegsjahr wird der 22-jährige verwundet. Gustav Kuhn meutert und verweigert den Kriegsdienst. Wegen Gehorsamsverweigerung wird er bestraft. Gustav Kuhn wird bis zum Kriegsende zunächst in der Festung Köln und anschließend in einer Strafkompanie im Schleswig Holsteinischen Moor bei Gallstedt in einer Strafkompanie gefangen gehalten. Nach dem Kriegsende und seiner Befreiung geht Gustav Kuhn nach Berlin und arbeitet in der Schlachterei seines Schwagers in Treptow.
In Berlin schließt er sich dem Spartakusbund an und „macht dort Revolutionskämpfe“ mit. 1919 wird Kuhn verhaftet und erneut bestraft. Im April 1922 zieht Gustav Kuhn nach Göttingen und wechselt hier in den folgenden zehn Jahren häufig seinen Wohnsitz. Bis 1933 arbeitet er bei der Terrazzofirma Scandolo als Arbeiter. Am 7.6.1930 heiratet Gustav Kuhn Luise Wild (geb. 2.10.1905 in Göttingen).
Seit 1929 ist Kuhn Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und hier von 1932 bis 1933 Hauptkassierer. Zudem ist er Mitglied der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO), Organisationsleiter des Kampfbundes gegen den Faschismus (KgF) sowie Kassierer der Roten Hilfe. Alle seine Ämter bzw. Mitgliedschaften führt er bis zu seiner ersten Verhaftung 1933 aus.
Ab Januar 1931 finden innerhalb der bereits zuvor bestehenden Antifaschistischen Arbeiterabwehr (“Antifa”) Richtungskämpfe statt, woraufhin Kuhn eine Göttinger Ortsgruppe des Kampfbundes gegen den Faschismus (KgF) gründet. Am 28.5.1931 veranstaltet der KgF einen „Propagandumzug“ durch Göttingen. In der Anmeldung vom 22.5.1931 bei der Polizeidirektion Göttingen bittet Kuhn um die Erlaubnis zur Mitführung eines Transparents „Arbeiter aller Parteien, werdet Mitglied des Kampfbundes gegen den Faschismus“ und kündigt an: „Kappelle spielt!“
Im April 1932 wird Gustav Kuhn vom Regierungspräsidenten in Hildesheim schriftlich mitgeteilt, dass eine für den 9.4.1932 im Volkshaus (Wiesenstraße) angemeldete Veranstaltung verboten sei. Zur Begründung werden Verstöße gegen die Notverordnung angeführt - der KgF habe vor dem „Universum“ in der Wiesenstraße trotz Verbot im März 1932 mehrfach Flugblätter verteilt.
Am 20.4.1932 meldet Gustav Kuhn für den KgF eine Propagandaaktion zur Preußenwahl an. Eine selber hergestellte Litfaßäule soll „an den Tagen Freitag, Samstag und Sonntag auf einem Wagen in den Straßen der Stadt Göttingen herum (...) fahren“. Auf den angebrachten Plakaten soll u. a. zu lesen gewesen sein: „Kämpft für Arbeit, Boden, Brot, Freiheit gegen Hunger, Krieg, Faschismus für Sowjetunion, für Sozialismus. Wählt Kommunisten Liste 4“ (s. S. 13, 20, 21 dieser Broschüre).
Die exponierte Rolle Gustav Kuhns rückt ihn bereits in der späten Weimarer Republik in den Fokus von polizeilichen Repressionen. Als am 12.8.1932 Hausdurchsuchungen in „Büro und Buchhandlung des internationalen Bundes der Opfer des Kriegs und der Arbeit, Johannisstraße 24“ sowie in den Privatwohnungen von 7 Kommunisten stattfinden, wird auch die Wohnung von Kuhn in der Angerstr. 11 durchsucht.
Nach der Machtübertragung an die Nazis gehört Gustav Kuhn in Göttingen zu den ersten Antifaschisten, die von Verhaftungen betroffen sind. Vom 1.3.-7.4.1933 wird Kuhn in Schutzhaft genommen. Hier tritt er gemeinsam mit dem KPD-Abgeordneten Adolf Reinecke und drei weiteren Gefangenen am 28.3.1933 in den Hungerstreik. In einem Beschwerde-Brief an die Polizei-Direktion begründet Kuhn, dass es zwei Tage zuvor zu einem Konflikt mit dem Polizei-Oberwachtmeister Dette gekommen sei. Dieser hatte provokant geäußert: „Wenn ihr ins Konzentrationslager kommt, da werden wir euch schon mürbe kriegen. Hier geht es euch zu gut, ihr fresst euch hier zu dick“.
An Gustav Kuhn wird 1933 von seinem Genossen Heinz Lechte eine Postkarte aus dem Lager Westerhof bei Osterode am Harz verschickt. In einem geheimen Code will Lechte seinem Genossen offenbar eine Nachricht zukommen lassen: „OTR NTRFO.“ ROT FRONT!
Am 19.8.1933 wird Kuhn erneut von der Polizei festgenommen und am 23.8.1933 in das Konzentrationslager Moringen und anschließend in das KZ Oranienburg überstellt. Zusammen mit seinen Genossinnen Else Heinemann und Elisabeth Vogel zählt Gustav Kuhn zu den ersten Häftlingen im KZ Moringen. Am 19.12.1933 wird er zunächst wieder entlassen. In den folgenden Monaten wird Kuhn zur Arbeit im Straßenbau bei der Hannöverschen Firma Plinke an der Autobahn gezwungen.
Von März bis Juli 1935 wird er in Hannover eingesperrt. Nach dieser Haft arbeitet Kuhn bei der Baufirma Hildebrandt in Göttingen. Am 26.11.1936 wird Gustav Kuhn erneut verhaftet und am 3.8.1937 zusammen mit sechs weiteren Göttinger KommunistInnen des „Hochverrats“ und „verbotener kommunistischen Betätigung“ angeklagt. In der Gestapo-Haft in Kassel (Wehlheiden) wird Kuhn auch von seiner Frau Luise belastet. Nach der Verurteilung am 14.9.1937 verbringt Gustav Kuhn seine Haftstrafe bis zum 14.4.1939 im Zuchthaus in Kassel. Im Anschluss nimmt ihn die Gestapo Hildesheim in Schutzhaft und verschleppt ihn im Mai 1939 in das Konzentrationslager Dachau (bei München). Auf Druck der Gestapo wird seine Ehe am 2.3.1943 zwangsgeschieden. Am 15.5.1943 heiratet sie den Transportarbeiter Otto Jakob.
Am 2.5.1945 wird Gustav Kuhn von der US-Army aus dem Konzentrationslager Dachau befreit. Als kranker und schwer gezeichneter Mann kehrt er 1945 nach Göttingen zurück. Ab dem 12.6.1945 ist Kuhn erneut in Göttingen im Maschmühlenweg 46 gemeldet. Am 15.8.1945 zieht er zu O. Jakob in die Deisterstr. 8. Seit dem 17.5.1946 wohnt er in der Petrosilienstraße 8. Kuhn arbeitet zwei Jahre in der Mensa. Auf Grund seiner 12-jährigen Inhaftierung, Schändung und Folterung ist er ab 1948 nicht mehr in der Lage zu arbeiten und muss bis zu seinem Tod um Wiedergutmachung und Entschädigung ringen. Unter der Nummer 34 wird er beim Sonderhilfsausschuss in Göttingen als anerkannter politisch Verfolgter geführt. Nachdem ihm die Entschädigungsgelder für sein tägliches Überleben erst bewilligt wurden, werden ihm diese ab Anfang der 1950er Jahre im Zuge der neu einsetzenden Kommunistenverfolgung wieder aberkannt.
Innerhalb der Göttinger KPD ist Gustav Kuhn weiterhin präsent, nimmt aber eine eher zurückgezogene und beratende Rolle ein, so die Zeitzeugin Karin Rohrig. Ihr Mann Karl-Heinz Rohrig bringt Kuhn regelmäßig die KPD-Zeitung in seine Wohnung in die Petroslilienstraße. Am 3.10.1954 stirbt Gustav Kuhn im Alter von 62 Jahren in Göttingen.
Auf Initiative des Vereins zur Förderung antifaschistischer Kultur e.V. wurde über Gustav Kuhn am 24. Mai 2012 im Kulturausschuss der Stadt Göttingen diskutiert. Die Ratsfraktion Göttinger Linke brachte hier am 9.5.2012 den Antrag „Anbringung einer Gedenktafel für Gustav Kuhn“ ein. Darin wurde die Stadt gebeten, „eine Gedenktafel für Gustav Kuhn an seinem letzten ehemaligen Wohnhaus Petrosilienstraße 8 anzubringen“. Zur Begründung hieß es: „Hätte es mehr mutige und weitsichtige Menschen wie Gustav Kuhn gegeben, hätte unermessliches Leid und Schaden abgewendet werden können. Diesen Teil der Geschichte halten wir für so bedeutsam, dass wir ihn auch in der offiziellen Geschichtsschreibung und Gedenkkultur der Stadt verankert sehen wollen“. Überraschend und im Gegensatz zur Argumentation in den Jahren zuvor lehnte die Göttinger Stadtverwaltung den Antrag nicht grundsätzlich ab, sondern unterbreitete einen eigenen weitergehenden Vorschlag. In einer Tischvorlage, die dem Kulturausschuss am 24.5.2012 vorgelegt wurde, erkannte der Fachbereich Kultur an, „dass die Göttinger Bürger - Kommunisten, Sozialdemokraten (ISK) und Menschen anderer politischer oder religiöser Prägung - die Widerstand geleistet haben (…), bisher noch in keiner angemessenen Weise in Göttingen gewürdigt werden“. Die Stadtverwaltung machte den Vorschlag „für eine andere Form des Gedenkens an diese Vertreter eines regionalen Göttinger Widerstands gegen die Nationalsozialisten. Zu denken wäre etwa an eine Erinnerungstafel am Gebäude der Stadtbibliothek. Dort im damaligen Stadthaus, befand sich das städtische Polizeigefängnis, in dem die meisten Opfer des Nationalsozialismus zunächst inhaftiert wurden“. Der Verein zur Förderung antifaschistischer Kultur zeigte sich erfreut, dass nun endlich Bewegung in die Diskussion um die angemessene Form der Würdigung des antifaschistischen Widerstands in Göttingen komme. Bisher gibt es in Göttingen lediglich zwei individuelle Gedenktafeln für Antifaschisten, die 1986 und 2004 gegen Widerstände in der Stadtverwaltung verwirklicht werden konnten.
Zwei Jahre später ist allerdings noch keine Gedenktafel an der Stadtbibliothek in Sicht. Stattdessen brachten AntifaschistInnen eigens gefertigte „Gedenktafeln“ in Form von Kacheln an den damaligen Göttinger Wohnorten Gustav Kuhns an. Die Debatte ist damit erneut eröffnet.
Louise und Karl Meyer
Louise Meyer wird am 4. Mai 1883 als Minna Johanne Louise Hesse in Bovenden geboren. Ihr Vater ist Schmiedemeister und ihr Bruder Geselle in der Schmiede. Ihr Vater verstirbt noch vor dem Zweiten Weltkrieg und ihr Bruder 1939. Louise ist eine kritische junge Frau, der das Leben auf dem Dorf in einer biederen Familie nicht zusagt. Sie verlässt Bovenden nach ihrer Schulzeit und geht nach Hamburg. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich hier als Haushaltshilfe.
Louise Meyer ist vor 1933 Hauptkassiererin der Roten Hilfe (RH) in Göttingen und außerdem etwa 4 Jahre lang Mitglied im Freidenkerverband. In der RH arbeitet sie unter anderem mit Gustav Kuhn zusammen.
Karl Meyer wird am 18. Februar 1879 in Weende geboren. Er ist gelernter Drechsler und führt ab 1908 eine eigene Werkstatt im Rosdorfer Weg 12, muss sie jedoch 1914, in der Inflationszeit, aufgeben. Während des Ersten Weltkrieges ist er Werftarbeiter in Wilhelmshaven und lernt dort beim Aufstand der Roten Matrosen Ernst Oehme kennen. Oehme arbeitet als Heizer auf der „Scharnhorst“ und gehört später der KPD Göttingen an. Seitdem sind die Familien Meyer und Oehme eng befreundet. Politisch orientiert sich Karl Meyer erst an der SPD, der er von 1906 bis 1908 angehört, 1922 tritt er ihr noch einmal Mal bei. Zwei Jahre später verlässt er die Partei wieder und gehört von nun an der KPD an und bekleidet im Jahr 1931 in Göttingen die Stelle ihres Zellenkassierers. 1932 beteiligt er sich an einer Waffensammlung für die KPD und händigt seinem späteren Mitangeklagten Adolf Reinecke ein Gewehr aus. Aufgrund seiner politischen Aktivitäten wird Karl Meyer vom 4. bis 6. April 1933 Opfer der Schutzhaftwelle. Am 2. und 3. Juni desselben Jahres wird er noch einmal verhaftet.
Am 30. Oktober 1910 heiraten Louise Hesse und Karl Meyer. Vorerst wn sie in Herberhausen, dort werden ihre beiden Kinder Heinrich am 3. März 1913 und Else am 30. April 1914 geboren. Später zieht das Ehepaar nach Göttingen in die Jüdenstraße 46. Ihre Wohnung dient als Treffpunkt für Göttinger KommunistInnen.
Zusammen mit fünf weiteren Genossen wird ihnen 1935 vorgeworfen, die Nazi-Verfassung mit Gewalt außer Kraft setzen zu wollen und zu diesem Zweck Agitation und Propaganda für die verbotene KPD zu betreiben. Während seiner Verhaftung in der Jüdenstraße 46 kann Karl Meyer gerade noch einen Geldboten der Roten Hilfe, der auf dem Weg zur Wohnung der Meyers ist, durch ein heimliches Zeichen warnen. Louise und Karl Meyer geben in den nun folgenden Verhören die Vorwürfe nicht zu, was unter den Verhörmethoden der Gestapo und dem Umstand, dass ihre Mitangeklagten umfassend ausgesagt haben, sehr bemerkenswert ist.
Karl Meyer sitzt vom 27. November 1936 bis zum 14. Oktober 1939 erst in Göttingen in Untersuchungshaft und dann in Wolfenbüttel in Haft, Louise Meyer ist ebenfalls für eineinhalb Jahre in Wolfenbüttel inhaftiert. Nach ihrer Entlassung zieht das Ehepaar ins Dachgeschoss der Gotmarstraße 4.
Bei der Bombardierung der alten Staats- und Unibibliothek (Paulinerkirche) am 24. November 1944 treffen Bombensplitter die Wohnung der Meyers, wobei einer in Louise Meyers Nähmaschine stecken bleibt. Glücklicherweise haben sie sich in dieser Nacht dazu durchgerungen in den Luftschutzbunker zu gehen, was sie bis dahin immer scheuten, da er sich drei Häuser weiter im Keller der Polizeiwache (heutige Stadtbibliothek) befindet. Nach diesem Ereignis zieht Louise Meyer ihren Mann zu ihrer Tochter Else nach Bovenden, die die dortige Schmiede leitet. Während des Krieges verstecken Else und sie in der Scheune der Schmiede den Genossen Willi Eglinsky, der es geschafft hat aus einem Konzentrationslager zu fliehen. 1944/45 trennt sich das Ehepaar Meyer. Karl Meyer bleibt in der Gotmarstraße wn. Louise Meyer zieht in ein Zimmer gegenüber der Wohnung ihres Ss Hanko in der Kapitän-Lehmann-Straße 9, wo sie in ihrer Rolle als Großmutter aufgeht.
Parteipolitisch ist sie nach 1945 nicht mehr aktiv, unterstützt aber die jüngeren GenossInnen mit ihrer Erfahrung. Allerdings erzählt sie von sich aus kaum etwas über die Zeit des Faschismus. Wie tief der Schrecken und die Angst dieser Zeit bei ihr sitzen, zeigt sich kurz vor ihrem Tod, wie ihre Enkelin Karin Rohrig erzählt. Sie durchlebt die Furcht vor der Gestapo und das Grauen des Nazi-Knasts wieder, gerät bei jedem lautem Geräusch in panische Angst und das Klopfen an der Tür versteht sie als Klopfzeichen, wie sie im Gefängnis üblich waren.
Am 8. März 1961 verstirbt Louise Meyer im Landeskrankenhaus Hannover. Fünf Jahre später stirbt auch Karl Meyer.
Internationalistische Geschichtspolitik
Wir wollen in unseren Auseinandersetzungen um Geschichtspolitik nicht in einer bundesdeutschen oder regionalen Perspektive verharren. Als internationalistische Antifagruppe verfolgen wir immer auch den Anspruch, unseren Kampf mit den emanzipatorischen Kämpfen, die auf der Welt geführt werden, in Beziehung zueinander zu setzen. Dieser Anspruch macht vor unseren Diskussionen zur eigenen Bewegungsgeschichte, zur Geschichtsschreibung und zur Ordnung von geschichtspolitischen Fragestellungen nicht halt. Es geht uns darum, ein umfassendes und komplexes Bild von der Geschichte zu erhalten, Verständnis und Bezüge zwischen historischen und aktuellen Auseinandersetzungen herzustellen sowie einen reflektierten und selbstbewussten Umgang mit Geschichte – auch mit einer internationalistischen Perspektive – zu entwickeln. Deshalb wollen wir nun unseren Blick über Deutschland (und Europa) während des Faschismus hinaus wenden. Die damaligen Kolonien waren nicht weniger in den Zweiten Weltkrieg involviert als Deutschland oder die Alliierten, wobei die Qualität und die Positioniertheit dessen selbstverständlich eine diametral gegensätzliche war.
Eine Auseinandersetzung mit Inhalten, das heißt mit Hintergründen und Motiven, bleibt in der deutschen Alltagskultur oft aus. Die eingangs der Broschüre thematisierten geschichtsrevisionistischen Verdrehungen und Instrumentalisierungen durch staatstragende Eliten werden an vielen Stellen deshalb von einem formalen Umgang mit der Geschichte begleitet. Wird Geschehenes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht direkt für die eigenen Interessen inhaltlich neu bestimmt, wird es v. a. anhand von Opferzahlen und markanten, für das eigene Erleben bedeutsamen Daten, aufgezählt.
Selbst dieses formale Geschichtsbild ist in der Regel unvollständig oder gar falsch. Die Geschichtsvermittlung über die Rolle der Menschen aus dem Trikont und Ozeanien stellt sich gänzlich anders dar als diejenige über die Rolle der Menschen aus Europa, den USA und Japan. Diese wurden bisher im Westen nur am Rande oder gar nicht gewürdigt. Da sie in Europa und den USA nur marginal in die Gedenk- und Geschichtsschreibung mit einbezogen wurden, muss ihrer Geschichte hier erst noch Gewicht verliehen werden. So fehlen die schätzungsweise 21 Millionen Menschen, die in China während des Zweiten Weltkriegs starben, in fast allen westlichen Statistiken.
Es gilt, auf Kontinuitäten hinzuweisen und das Blickfeld zu erweitern. Bspw. endete der Krieg zwar am 8. Mai 1945 in Europa, der Zweite Weltkrieg endete aber erst am 2. September 1945 mit der Kapitulation Japans. Für die Menschen in den ehemaligen Kolonien folgte nach Ende des Zweiten Weltkriegs im entstehenden Machtvakuum unmittelbar der Versuch der imperialistischen Staaten, koloniale Ordnung wieder herzustellen. So begann bspw. mit einem Massaker an 40.000 Menschen durch die Kolonialmacht Frankreich am 8. Mai 1945 der algerische Unabhängigkeitskrieg. Die folgenden Befreiungskämpfe auf der ganzen Welt standen unter den Voraussetzungen der Systemkonfrontation unter Führung der USA und der Sowjetunion (SU).
Eurozentrismus in der deutschen ArbeiterInnenbewegung
Das Ausblenden der Rolle Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und Ozeaniens vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg ist nicht allein ein Phänomen der Mehrheitsgesellschaft, sondern trifft auch für die Linke zu. Der Ausgangspunkt für diese Blindheit ist bereits in der deutschen ArbeiterInnenbewegung angelegt. Während wir heute einen geschichtlich distanzierten Blick auf den deutschen Kolonialismus Ende des 19. Jhds. werfen, befand sich die ArbeiterInnenbewegung in der Situation, mitten in dieser Zeit zu agieren. Die Sozialdemokratie zeichnete in dieser Frage leider eine teilweise sehr rassistische Haltung aus. Die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften waren zu keinem Protest bereit, als am 26.2.1885 auf der „Berlin Conference (1885)“ – in Deutschland die sog. „Kongo-Konferenz“ – der „Rest der Welt“ unter den westlichen Kolonialmächten aufgeteilt wurde. Für das deutsche Reich bedeutete diese Konferenz die Anerkennung als Kolonialmacht durch die Pioniere des Kolonialismus: Großbritannien, Frankreich, Holland usw. In einer Reichstagsrede am 4.3.1885 reagierte Wilhelm Liebknecht auf die Beschlüsse der „Berlin Conference“ zwar mit einer klaren Ablehnung, aber diese wurde nur mit den Interessen der deutschen Arbeiter begründet.
Die Sozialdemokraten vermuteten in der Bereitschaft der Bismarck-Regierung zum „Erwerb“ von Kolonien den Versuch, die in den kommenden Wirtschaftskrisen befürchteten Klassenauseinandersetzungen zu entschärfen. Sie schrieben damit der deutschen Kolonialpolitik lediglich eine innenpolitische Ventilfunktion zu. Die 400-jährige Geschichte des Kolonialismus spielte in ihrem Politikverständnis kaum eine Rolle. Zudem zeichnete die sozialdemokratische Haltung eine wirkliche Unklarheit zu Positionen des Imperialismus und des Kolonialismus aus. So verstanden sie neue kolonialistische Handelswege nach Übersee in die „nicht-zivilisierten“ Regionen bspw. als „Kulturträger“. Dieses Zivilisationsargument tauchte in der SPD hier erstmals auf und entsprach dem marxistischen evolutionistischen Schema der Gesellschaftsentwicklungen von Feudalismus über Kapitalismus hin zum Sozialismus bis zum Kommunismus. Von Friedrich Engels bis Rosa Luxemburg wurde – mal kulturalistischer, mal materialistischer argumentierend – eine Revolutionsmarschordnung propagiert, in der die industrialisierten Länder die Avantgarde und der „Rest der Welt“ ein bloßes Anhängsel sein würden. Auf dem Londoner Kongress der Zweiten Internationale 1896 wurden die kolonisierten Länder aufgefordert, in die Reihen der Internationale zu treten und ihren Kampf zu unterstützen, statt zu fragen, was die europäischen ArbeiterInnenbewegungen ihrerseits an praktischer Solidarität für die Kolonisierten leisten können.
Später erkannte auch Ho Chi Minh, dass die ArbeiterInnenbewegungen in Europa nicht unbedingt solidarisch mit Kämpfen in der Welt waren. Er sagte über seine Zeit bei der Sozialistischen Partei Frankreichs in Paris: „(...) Was mich am meisten interessierte – bei den Treffen jedoch nie zur Sprache kam – war folgendes: Welche Internationale stand auf Seiten der Völker in den kolonialisierten Ländern? (...) Zuvor hatte ich bei den Versammlungen der Zelle den Diskussionen nur zugehört. Ich hatte das vage Gefühl, dass die Beiträge aller Redner eine gewisse Logik enthielten, und konnte nicht herausfinden, wer Recht hat und wer Unrecht. Doch von jetzt an beteiligte ich mich selbst an den Debatten, und zwar mit großer Leidenschaft ... Mein einziges Argument lautete: ‘Wenn ihr den Kolonialismus nicht verdammt, wenn ihr euch nicht auf die Seite der kolonialisierten Völker schlagt, was für eine Art von Revolution führt ihr dann?’“
Dass es damals wie heute bei der Frage nach der internationalen Solidarität weniger um Mildtätigkeit oder „wer etwas für wen leisten könne“ geht, sondern um das Bewusstsein über die Zusammenhänge von weltweiten Macht- und Ausbeutungsverhältnissen, die Dynamiken kapitalistischer Krisen und die Antworten, die die Herrschenden darauf bereit halten, führte schon der Erste Weltkrieg vor Augen. Die fehlenden Begrifflichkeiten vom Wesen des deutschen Kolonialismus, vorherrschender Nationalismus und die Tendenz zur Korrumpierung mit den Mächtigen ließen nicht nur die deutsche Sozialdemokratie sehenden Auges in den Ersten Weltkrieg laufen. Dieser war ein Krieg der imperialistischen Staaten, der nicht zuletzt geführt wurde, weil die Kolonialreiche an die Grenzen der – 1885 noch einvernehmlich arrangierten – kolonialen Expansion gestoßen waren.
Diesen folgenschweren Fehlern der ArbeiterInnenbewegung steht die Tradition des „Proletarischen Internationalismus“ positiv entgegen. Anders als 25 Jahre später meuterten und streikten die ArbeiterInnen und Soldaten im November 1918 den Weltkrieg nieder. Das „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ stand dem Nationalismus entgegen und lieferte die Basis für wichtige weitere Kämpfe. Ausgangspunkt des Proletarischen Internationalismus war der Gedanke, dass die ArbeiterInnenklasse im internationalen Kapital einen gemeinsamen Klassenfeind hat und deshalb international vereinigt agieren muss.
In den 1930er Jahren folgten über 5.000 deutsche AntifaschistInnen in den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg dieser internationalistischen Idee: sie kämpften gegen den Faschismus, für die soziale Revolution oder für die Verteidigung der Republik gegen die putschenden Truppen des faschistischen Generals Franco. Ihr Einsatz in Spanien war immer auch ein Kampf gegen den Faschismus in Deutschland. Im Spanischen Bürgerkrieg wurde bereits ab 1936 verhandelt und ausgekämpft, welche Seite – die sozialistische oder faschistische – sich in Europa zunächst durchsetzen würde. Italienische und deutsche faschistische Truppen unterstützten Franco und machten den Spanischen Bürgerkrieg damit zum Testfeld für weitere militärische Aggressionen und Vernichtungskriege. In den 5 Internationalen Brigaden kämpften insgesamt 40.000 AntifaschistInnen aus mehr als 50 Nationen. Nach ihrer größten Niederlage, den Faschismus, die Shoa und den Zweiten Weltkrieg nicht aufgehalten zu haben, waren es nun v. a. deutsche AntifaschistInnen, die auf die internationale Solidarität ihrer GenossInnen angewiesen waren.
Japanischer Faschismus – Korea.
Sexuelle Versklavung & Entschädigungsforderungen
Neben Deutschland und Italien war Japan bedeutender Akteur des Zweiten Weltkriegs. Während der „Pazifikkrieg“ oder „Pearl Harbour“ bekannte Begriffe in der deutschen Geschichtsschreibung sind, so sind die Ideologie, die Japan verfolgte, und das Ausmaß der japanischen Gräueltaten wenig bekannt und hierzulande nur schwer zu recherchieren.
Ausgangspunkt für eine Einordnung der damaligen Geschehnisse in Japan sind für uns Analysen von japanischen Antifaschisten, die vor und während des Zweiten Weltkriegs gelebt haben. Tosaka Jun beispielsweise, Mitglied der Kommunistischen Partei Japans; oder Maruyama Masao, ein japanischer antifaschistischer Christ, die beide in den 1930/40er Jahren gewirkt haben, verfassten Texte über „japanischen Faschismus“ (fashizumu), um die Entwicklungen in Japan in einen weltweiten Zusammenhang zu stellen, anstatt eine japanische „Ausnahme“ zu suchen und die Verhältnisse damit zu entpolitisieren.
In Italien und Deutschland war der Beginn der faschistischen Systeme mit Mussolinis Machtantritt im Oktober 1922 und die Machtübergabe an Hitler im Januar 1933 genau auszumachen. In Japan hingegen gab es durch eine schrittweise Annäherung zum Faschismus keinen klaren Zeitpunkt, in dem die faschistische Bewegung durch die Übernahme der Staatsmacht eindeutig zur faschistischen Herrschaft gelangt. Der japanische Faschismus entstand während der Shôwa-Krisenkette in den 1920er Jahren. Diese hatte schwere soziale und ökonomische Verwerfungen und einen sich verschärfenden Klassenkampf zur Folge. Kapitalisten und Grundbesitzer sahen sich als Bewahrer des Tennô-Systems mit dem Kaiser an der Spitze der Gesellschaft, das sich den Krisen einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt sah: durch eine sich radikalisierende Bauernschaft, Industrie-Streiks, eine sich emanzipierende Frauenbewegung und selbstbewusste StudentInnen. Die Oktoberrevolution von 1917 im benachbarten Russland tat ihr übriges, um den Kapitalismus auch in Japan als überwindbar erscheinen zu lassen.
Die japanischen Faschisten versprachen das Ende der Klassengesellschaft durch das Heraufbeschwören eines Staates und einer Nation, die durch „natürliche Blutsbande des Volkes“ geeint würden. Während für die italienischen Faschisten der Staat als Mittelpunkt aller Maßstäbe galt und die deutschen Nazis der „Volksgemeinschaft“ die Vorrangstellung gewährten, betrachteten die japanischen Faschisten den Tennô als Urquelle aller Ideen und Normen sowie als „Inkarnation höchster Tugend“. Staat und „Volksgemeinschaft“ wurden in Japan lediglich als Vollstrecker der Werte des Kaisers angesehen. Sein Wille war absolut und total.
Soziale Basis des sich entwickelnden japanischen Faschismus stellten die Mittelklassen dar. Ihnen war es – im Gegensatz zu den ArbeiterInnenklassen – auf Grund ihrer organisatorischen Schwäche unmöglich, eigene Interessen und soziale Positionen mittels eines Klassenkampfes durchzusetzen. Die Kontrolle über das Monopolkapital und die Garantie von „Sicherheit und Ordnung“ in der Gesellschaft durch einen starken Staat, erschien den Mittelklassen für die Bewahrung ihrer erworbenen Rechte und ihrer Position als „Zentrum der Gesellschaft“ notwendig.
Seit den 1920er Jahren schlossen sich die bis dahin zerstreut operierenden, elitären rechten Bewegungen von Zivilisten mit rechten Teilen des Militärs zusammen. Die Militärs übernahmen von nun an die Führung der faschistischen Bewegung und setzen sich mit ihrer militärisch-faschistischen Politik im Staat durch. Innenpolitisch hatte das Militär seit den 1870er Jahren verfassungsmäßig garantierte Rechte durch eine direkte Verbindung zum Tennô.
Im faschistischen Deutschland und Italien wurde zunächst innerhalb der Bevölkerung die Herrschaft stabilisiert und danach die militärische Invasion im Ausland als Vollstreckung der ideologischen Ansprüche auf Erweiterung des „Lebensraums“ propagiert. In Japan ging die äußere Expansion der inneren Stabilisierung des faschistischen Systems voraus. Militärische Aktionen nach außen waren in Japan unmittelbar mit der inneren Stabilisierung des Herrschaftssystems verbunden. Die totale Mobilisierung der Massen im Sinne des Faschismus, die die Militärs beabsichtigten, wurde nur dann möglich, als die „große Illusion“ für die Verwirklichung einer neuen Verteilung der Machtsphäre der Welt zugunsten Japans im Bewusstsein der japanischen Massen fest verankert war.
Ab 1928 wurden Möglichkeiten der Meinungsäußerungen eingeschränkt und Linke inhaftiert. Der Marxismus war dabei nicht das einzige Angriffsziel. Die Kampagnen richteten sich auch gegen vermeintlich europäisches Gedankengut wie Individualismus, im Gegensatz zum asiatischen Konzept des kommunitaristischen Kollektivismus. Ab 1937 war es der Regierung neben der Bekämpfung linker Ideen daran gelegen, Verständnis für die „großasiatische Neuordnung“ (Daitôa shintaisei) zu verstärken. Gemäß dieser außenpolitischen Zielsetzung richtete sich die Erziehungspolitik auf zwei Aufgaben: die Ausbildung von kaiserlichen Untertanen, um die Eskalation des Krieges gegen China ideologisch zu unterstützen sowie die Ausbildung einer „großen Nation“ als künftigem „Führer in Ostasien“. Mit der weiteren Eskalation des Weltkrieges spitzten sich auch Ideologie und Organisationsform des japanischen Faschismus zu: 1940 wurden alle verbliebenen Parteien Japans von der faschistischen Bewegung „Abgeordnetenbund zur Durchführung des heiligen Krieges“ (Seisen kantetsu giin renmei) verboten. Die ersten Kriegserfolge der deutschen Wehrmacht in Europa waren unmittelbare Ursache für die schnelle Entwicklung zur Auflösung der Parteien und zur „Neuordnungs-Bewegung“ in Japan.
Der rechte Zusammenschluss aus Militärs und Faschisten vertrat die „Asiatische Monroe–Doktrin“, die darauf zielte dass Japan die Weltordnung von England und den USA zumindest in Asien durch kompromisslose militärische Konfrontation durchbricht. Die Angelegenheiten in Asien sollten so von AsiatInnen selbst gesteuert werden. Mit der Vorstellung „Asien den Asiaten“ sahen die japanischen Faschisten einem Großasiatischen Reich entgegen, mit JapanerInnen als „Herrenrasse“ an der Spitze. Zur Mobilisierung von Bündnispartnern in der Weltregion wurde diese Ideologie mit einer Rhetorik der „Befreiung der asiatischen Völker von der Kolonialherrschaft“ verknüpft. Diese vorgebliche antikoloniale Befreiung war unmittelbar mit dem Machtanspruch auf die ost- und südostasiatischen Territorien verschränkt und diente in der späteren Besatzung als ideologische Rechtfertigung für den imperialistischen Krieg gegen China und die anderen asiatischen Staaten. Bereits seit 1910 hielt Japan Korea besetzt, 1931 begann mit dem „Mandschurischen-Zwischenfall“ der Krieg gegen China. Kriegsführung und Besatzung sind vielerorts als Vernichtungskrieg gegen die chinesische Bevölkerung zu bezeichnen: Mit Massakern an der Zivilbevölkerung, systematischen medizinischen Menschenversuchen und sexueller Versklavung von Frauen überzogen die Japaner bis August 1945 große Teile Ost-/Südostasiens und Ozeaniens.
Nach diesen Ordnungen des japanischen Gesellschaftssystems vor und während des Zweiten Weltkrieges wollen wir als linksradikale Gruppe mit antifaschistischem und internationalistischem Ansatz nun einen bestimmten Ausschnitt aus der faschistischen Politik Japans fokussieren: mit einem feministischen Schwerpunkt beleuchten wir nachfolgend das patriarchale Gewaltverhältnis Japans. Die japanische Armee betrieb zwischen 1932 und 1945 in den besetzten Ländern ein System von Militärbordellen. Etwa 200.000 Mädchen und Frauen wurden in diese Vergewaltigungshäuser verschleppt oder gelockt. Neben 80.000 bis 120.000 Koreanerinnen gehörten dazu auch Frauen aus China, den Philippinen, dem damaligen Malaya, Burma, Osttimor und Indonesien. Die verharmlosenden Begrifflichkeiten „jungshindae“ (koreanisch: „den Körper freiwillig für die Arbeit einsetzen“), „comfort stations“, oder „Trostfrauen“ sollen darüber hinwegtäuschen, dass Japan im Zweiten Weltkrieg systematische sexuelle Sklaverei betrieb.
Nach der Befreiung vom japanischen Faschismus und der Rückkehr in ihre Herkunftsländer schwiegen die meisten Frauen aus Scham und Angst vor familiärer und gesellschaftlicher Ächtung über die an ihnen verübten Verbrechen. Erst der Auftritt einer Leidensgenossin im koreanischen Fernsehen rüttelte viele Frauen nach 46 Jahren auf. Kim Hak-Sun sprach 1991 über ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und forderte Frauen, denen ähnliches angetan wurde, auf, gemeinsam aktiv zu werden. Der „Koreanische Rat für den sexuellen Missbrauch durch das japanische Militär zwangsrekrutierter Frauen“ ermutigte viele ehemalige Zwangsprostituierte dazu, an die Öffentlichkeit zu treten und von der japanischen Regierung ein Schuldeingeständnis, Abbitte und Entschädigung zu fordern: „Wir erwarten, dass die japanische Regierung die Wahrheit enthüllt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht, sich offiziell für diese Verbrechen entschuldigt, die Opfer (...) entschädigt, die Geschichtsbücher korrigiert und ein Mahnmal errichtet“. Seit Januar 1992 demonstrieren die Frauen mit UnterstützerInnen wöchentlich vor der japanischen Botschaft in Seoul, im Frühjahr 2011 fand die eintausendste Kundgebung statt. Japan ist bisher nicht auf die Forderungen der Frauen eingegangen.
Im Dezember 2000 veranstalteten Frauen aus verschiedenen Ländern in Tokio ein Internationales Kriegsverbrechertribunal über sexuelle Versklavung durch die japanische Armee 1932 bis 1945. Nach der bewegenden Anhörung von Zeuginnen bewertete das Tribunal das System der Zwangsprostitution im Zweiten Weltkrieg als integralen Bestandteil der Kriegsstrategie des japanischen Staates. Den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges legte das Tribunal zur Last, die Verbrechen nach Kriegsende nicht verfolgt und die Täter so unbelangt gelassen zu haben.
In Japan werden die koreanischen Frauen von feministischen Initiativen und MenschenrechtsaktivistInnen unterstützt. Sie sammeln Informationen, leisten Öffentlichkeitsarbeit oder übergeben gemeinsam mit den ehemaligen Zwangsprostituierten gesammelte Unterschriften. Seit Oktober 2009 hat eine neue japanische Regierung immerhin eine „Arbeitsgruppe zur Vergangenheitsbewältigung“ eingerichtet. Doch auch diese erste Reaktion ist ein zynisches Spiel auf Zeit. Der Nachfolgestaat des japanischen Faschismus spekuliert darauf, dass die Frauen irgendwann zu alt und zu wenige sein werden, um ihre Stimme zu erheben.
Die Erfahrungen, die die Frauen bei der Suche nach internationaler Unterstützung gemacht haben, verdeutlichen die heiklen Bezüge der Themen „Entschädigungsforderungen, Krieg und sexualisierte Gewalt gegen Frauen“ zur Gegenwart. Einerseits haben die Koreanerinnen wichtige Erfolge erzielt: Sie erwirkten Resolutionen in den Parlamenten der USA und Kanadas. Auch vor dem Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages wurden sie im Dezember 2010 empfangen. Tatsächlichen diplomatischen Druck gegen Japan werden diese Verbündeten allerdings kaum folgen lassen. Deutschland hat genug eigenen Dreck unter dem Teppich: Im Zweiten Weltkrieg wurden sowohl für die deutsche Wehrmacht aber auch in den Konzentrationslagern Zwangsbordelle betrieben. Frauen wurden mit Gewalt aus den besetzten Gebieten oder Konzentrationslagern verschleppt und zur Prostitution gezwungen. Als Opfergruppe sind sie bis heute nicht anerkannt. Anfang des Jahrtausends hat Deutschland unter der rot-grünen Bundesregierung die Entschädigungsforderungen ehemaliger ZwangsarbeiterInnen mit einem Almosen abgespeist und die deutschen Konzerne so vor internationalen Klagen bewahrt. Und Krieg – das wissen die USA, Kanada, Deutschland und Japan gemeinsam – ist das staatlich organisierte und legitimierte Morden durch Männer, bei dem Gewalt und Vergewaltigung gegen Frauen dazu gehören. Die lange Liste der öffentlich skandalisierten Ausbildungspraxen bei der Bundeswehr lassen erahnen, worauf sich Soldaten für ihre Kampfeinsätze vorbereiten. Dazu gehören auch eingeübte Scheinerschießungen, Folterpraktiken, Kreuzigungen und Vergewaltigungen. Im Frühjahr 1996 hielten Soldaten der Bundeswehr diese Vorbereitungen auf ihren Einsatz in Bosnien auf dem Truppenübungsplatz der Infanterieschule im bayerischen Hammelburg auf Fotos und Videos fest. In Regionen mit erhöhter Militärpräsenz, wie beispielsweise dem Kosovo, floriert das Geschäft mit der sexualisierten Gewalt. Im US-amerikanischen Militärgefängnis in Abu Ghraib im Irak wurden auch männliche Häftlinge von US-amerikanischen SoldatInnen sexuell gedemütigt, was 2004 ebenfalls mittels Fotos an die Öffentlichkeit gelangte.
Der Kampf der koreanischen Frauen für Würde und Entschädigung kann weitergehende Impulse liefern: Das bewegende Schicksal der Frauen kratzt an der zunehmenden Enthemmung des Militärischen und offenbart das bestialische Wesen des imperialistischen Krieges.
Faschismus-Begriff
fashizumu: Die Verwendung des Faschismus-Begriffs beinhaltet in Deutschland eine politische Positionierung. Anders als manchen bürgerlichen Analysen geht es uns nicht um eine bloße Formbeschreibung. Marxistische Faschismustheorien setzen eine bürgerlich-kapitalistische Herrschaftsform voraus und gehen von bestimmten historischen Bedingungen aus. Trotz der Besonderheiten unterschiedlicher Phänomene rechter terroristischer Herrschaft in verschiedenen Ländern gehen wir von vergleichbaren Merkmalen aus, die es ermöglichen, den Begriff des Faschismus für die Charakterisierung einer spezifischen rechten Herrschaftsform zu benutzen. dass diese Aufzählung erschöpfend ist, sind diese: Die sogenannte Volksgemeinschaftsideologie als Ersatz für soziale und ökonomische Klassenauseinandersetzungen. Eine kapitalistische Ökonomie, die aus einem organisch-hierarchischen Weltbild abgeleitet wird und die kriegerisch-imperialistisch ausgerichtet ist. Ein ausgeprägter Nationalismus, Rassismus und speziell in Deutschland der Antisemitismus als aggressive Feindbild-Ideologien. Autoritäre-diktatorische Staatsvorstellungen, die sich gegen demokratische, liberale und sozialistische Gesellschaftsbilder wenden. Ein organisatorisches Führer- und Unterordnungsprinzip mit soldatischen Verbands- und Kampfstrukturen. Ein messianischer Erhöhungs- und Allmachtsglaube, der die Ausschaltung von allem vorgeblich Gemeinschaftsschädlichem beinhaltet. Ein biologistisches und mystisches Menschenbild, das gegen Aufklärung, Liberalismus und Universalismus gerichtet ist. Mit dem Element des eliminatorischen Antisemitismus und des entfesselten Vernichtungskrieges im Osten brachte Deutschland die aggressivste Form des Faschismus hervor. Aber auch andere Herrschaftsformen in Italien, Ungarn, Spanien oder eben Japan lassen sich unter dem Begriff Faschismus fassen. Heute benutzen wir den Begriff des Neofaschismus für Personen oder Strukturen, die sich auf ihr historisches Vorbild beziehen. Innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft ist der antifaschistische Kampf ein wichtiger Ansatzpunkt zur Alarmisierung, um rechten Tendenzen entgegenzutreten. Die Antifaschistische Aktion ist in diesem Sinne die Sammlungsbewegung mit historischen Bezügen auf die ArbeiterInnenbewegung der 1930er Jahre und die autonomen Bewegungen der 1980er und 90er Jahre.
„Dritte Welt“
Der Begriff „Dritte Welt“ war ursprünglich ein Kampfbegriff z. B. Frantz Fanons, der damit das weltweite hierarchische Machtgefälle bezeichnet hat. Wir sprechen allerdings von einer anderen Position aus. In Europa benutzt steht der Begriff im Kontext der Modernisierungstheorie die besagt, dass sich Länder der „Dritten Welt“ in „westliche“, kapitalistische Richtung „entwickeln“ sollen. Deshalb lehnen wir den Begriff ab und ziehen „Trikont und Ozeanien“ vor. „Trikont“ bezeichnet aus antikolonialer Perspektive die Kontinente Asien, Lateinamerika und Afrika. Er bezieht sich auf die „Trikontinentale-Konferenz“ 1966 in Havana/Cuba, auf der über Dekolonisierung beraten wurde. In der Frage der Mittel wurde sich für militanten Widerstand entschieden. Che Guevara verfasste 1967 eine Botschaft an die Konferenz, die zum bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus, besonders die USA, aufrief. Die Botschaft war Anlass für Debatten darüber, ob und wie Verbindungen mit internationalen, bewaffnet kämpfenden Organisationen wie der Black Panther Party, dem Vietcong, der ETA, IRA und der PFLP aufgenommen werden können. In West-Berlin fand die Debatte ihren Höhepunkt auf dem Internationalen Vietnam-Kongress 1968. Dort wurde ein linksradikales Verständnis von internationaler Solidarität gegenüber dem Trikont formuliert, indem die westliche Linke die imperialistischen Staaten aus dem „Herzen der Bestie“ heraus angreifen müsse.
Aus diesem politischen Bezugspunkt heraus beziehen wir uns positiv auf den Begriff „Trikont“. Dabei wird jedoch ein ganzer Kontinent – Ozeanien – ignoriert und muss deshalb explizit mit genannt werden.
Algerien – Frankreich
Befreiung von Faschismus und Kolonialismus
Wir wollen nun unsere Perspektive, den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung vom Faschismus in Europa anzusehen, kritisch beleuchten. Für alle Überlebenden der Konzentrationslager, für alle AntifaschistInnen und KriegsgegnerInnen war der 8. Mai in Deutschland ihre Befreiung vom Faschismus. Der deutsche Faschismus war besiegt, und die Shoah hatte ein Ende. Für die Menschen in den KZs oder in den Folterkellern der Nazis markiert der 8. Mai 1945 das Überleben und den Sieg über die von den Nazis beschlossene Vernichtung. Für hunderttausende ZwangsarbeiterInnen in den Arbeitslagern deutscher Unternehmen endete ihre brutale Ausbeutung. Allein in Göttingen und Umgebung wurden über 20.000 ZwangsarbeiterInnen mit dem Vormarsch der alliierten Truppen befreit. Wir nehmen die Perspektive dieser Menschen in den heutigen Diskussionen ein und machen sie innerhalb der deutschen Gesellschaft zu unserem Standpunkt. Deshalb bleibt dieser Tag für uns ein Grund zum Feiern – damals wie heute! Er markiert ein symbolisches Datum.
Während der 8. Mai für uns in Deutschland ein positives Datum ausmacht, trifft dies im internationalen, antikolonialen Kontext nicht zu. Denn am 8. Mai 1945 begannen gewalttätige Repressionen gegen diejenigen, die als Kanonenfutter wesentlich dazu beigetragen haben, Frankreich einen Platz unter den „Siegermächten“ gegen den Faschismus in Europa zu verschaffen. Im Zweiten Weltkrieg hatte das „Freie Frankreich“ unter de Gaulle in seinen Kolonien 136.000 Algerier als Soldaten eingezogen. Viele Algerier meldeten sich auch freiwillig in der Hoffnung, dass das Ende des Krieges auch ihnen selber Freiheit bringen würde. So jedenfalls hatte es Frankreich versprochen. Etwa 12.000 Algerier starben für die Befreiung Europas vom Faschismus. Am 8. Mai 1945 fanden überall in Algerien Siegesfeiern statt, auch um de Gaulle an sein Versprechen zu erinnern. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen französische Kolonialisten, Milizen und das Militär in die Mengen schossen. Es folgten grausame Massaker an der algerischen Bevölkerung. Französischen Quellen zufolge starben an diesem Tag 6-8000 AlgerierInnen, algerischen Quellen zufolge aber starben 45.000 Menschen. So erlebten die AlgerierInnen nach dem Ende des Faschismus abermals die Barbarei des Kolonialismus in brutalster Form. Der 8. Mai ist in Frankreich ein nationaler Feiertag, in Algerien jedoch ein Tag der Trauer.
Die Massaker vom 8. Mai 1945 hatten wesentlichen Einfluss auf die Entstehung einer bewaffneten Befreiungsbewegung in Algerien. Die algerische Befreiungsbewegung FLN (Front de Libération Nationale) musste 8 Jahre lang von 1954 bis 1962 für die Unabhängigkeit ihres Landes kämpfen. Während dieses Befreiungskrieges töteten die Franzosen eineinhalb Millionen Menschen, ein sechstel der algerischen Bevölkerung. Für die grausamsten Verbrechen setzte Frankreich in seinen Kolonien Algerien und Vietnam ehemalige deutsche Wehrmachtssoldaten ein, die nach dem Sieg über Deutschland in die französische Fremdenlegion geworben wurden.
Das bildreiche Beispiel des 8. Mai 1945 in Europa und in Algerien verdeutlicht die doppelte Herausforderung, vor der wir uns als AntifaschistInnen in Deutschland sehen: Auf der einen Seite – innerhalb des Kontextes der deutschen Mehrheitsgesellschaft – feiern wir den 8. Mai als Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus und würdigen die Leistungen der Alliierten. Auf der anderen Seite – im Kontext der fortschreitenden Weltaufteilung – handelt es sich bei den alliierten westlichen Befreiern um imperialistische Staaten, die gleich nach dem militärischen Sieg über die deutschen, italienischen und japanischen Faschisten ihren Antikommunismus und die Aufrechterhaltung ihrer kolonialen Herrschaft in den Vordergrund stellten. Nach dem Sieg über die Nazis hatten die westlichen Alliierten kein ernsthaftes Interesse daran, die alten faschistischen Eliten zu entmachten oder einen tieferliegenderen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Die USA, Großbritannien und Frankreich setzten hierzulande in ihren Besatzungszonen auf Restauration. In ihren Kolonien setzten sie auf blanken Terror, um ihre Einflusssphären zu sichern und die beginnende Dekolonisierung zu verzögern.
Der Zweite Weltkrieg als Ausgangspunkt antikolonialer Befreiungskämpfe
Das Ende des Zweiten Weltkriegs hatte unmittelbare Auswirkungen auf die kolonisierten Länder, in denen sich nun antikoloniale Befreiungsbewegungen entwickelten. Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg übernahmen im algerischen Befreiungskampf führende Rollen.
Die Franzosen beschworen die Menschenrechte und die Werte der Aufklärung, aber Soldaten des Freien Frankreich, wie bspw. Frantz Fanon, bekamen in der französischen Armee zugleich zu spüren, wie es einer unterdrückten Minderheit erging. Als Soldat aus Martinique wurde Fanon besser behandelt als jene aus den afrikanischen Kolonien. Doch auch Fanon war täglich mit Rassismus in der Armee konfrontiert. Die Europäer benutzten die Afrikaner als Kanonenfutter und duldeten „Schwarze“ höchstens als Übersetzer neben sich. Seite an Seite mit den eigenen Kolonialherren kämpfend und dieselben Schmerzen erleidend erkannten die Kolonisierten, dass sie eigentlich nichts voneinander trennt. Die „weißen“ französischen Soldaten bezogen sich stattdessen aber eher positiv auf deutsche Soldaten als auf ihre „schwarzen Kameraden“. Diese Erfahrungen haben das Bewusstsein der Kolonisierten verändert, die ihr Leben für ihr „Mutterland“ gaben oder riskierten, also für das Land, das sie kolonisierte, und das sie gleichzeitig als Menschen dritter Klasse behandelte.
Kurz vor dem Sieg der Alliierten ordnete de Gaulle an, „schwarze“ afrikanische Soldaten durch „weiße“ Franzosen zu ersetzen, um Franzosen an der Befreiung Frankreichs und dem militärischen Sieg teilhaben zu lassen. Nachdem afrikanische Soldaten maßgeblich zum Sieg beigetragen hatten, wurden sie von ihren Frontpositionen abgezogen, wobei sie ihre Waffen und Uniformen abgeben mussten. Dem Sieg zum Greifen nahe, wurde ihnen erklärt, dass ihre Dienste nun nicht länger benötigt würden und sie auf ihren Rücktransport nach Afrika zu warten haben.
Auch der Einsatz afrikanischer Soldaten in Süd- und Südostasien brachte festgefügte Vorstellungen ins Wanken. Sie konnten erkennen wie die britischen Kolonialisten die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gezielt gegeneinander ausspielten oder benutzten. Die Aufenthalte als Soldaten in den verschiedenen Weltregionen führten zu Diskussionen mit Menschen anderer kolonisierter Länder über Unabhängigkeit und Freiheit. So schloss sich auch Chin Peng aus dem damaligen Malaya mit 15 Jahren der Malayan People‘s Anti-Japanese Army (MPAJA) an. Als späterer Generalsekretär der Kommunistischen Partei Malaysias schrieb er in seinen Memoiren „My side of History“: „Jeder von uns hat die Wahl – wir können standhaft sein oder Kompromisse eingehen, wir können Geld sparen oder aus dem Fenster werfen, wir können jemanden kritisieren oder einfach wegschauen, wir können vergessen oder erinnern. Ich persönlich entschied mich, Freiheitskämpfer zu werden. (...) Ich konnte keinerlei Kompromisse mit den Japanern schließen. Ebensowenig hätte ich mich jemals mit einem System arrangieren können, das einzig auf dem Fortbestand des britischen Kolonialismus baute“.
Das Image der Überlegenheit der Europäer, mit dem der Kolonialismus unter anderem legitimiert wurde, war durch die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Die westlichen Imperien waren zunächst nicht in der Lage, den deutschen, italienischen und japanischen Angriffen zu widerstehen. Der Mythos von den unbesiegbaren Kolonialherren war zerbrochen. Auch kümmerten sich die USA, Großbritannien oder Frankreich nicht um das Schicksal der Zivilbevölkerungen in ihren Kolonien. Diese standen dem faschistischen Terror alleine gegenüber und organisierten häufig einen opferreichen aber erfolgreichen Guerillawiderstand gegen die faschistischen Besatzer. Das so gewonnene Selbstbewusstsein, die gesammelten Erfahrungen und die militärische Ausrüstung legten es vielerorts Nahe, eine Neuauflage des alten Kolonialismus nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu akzeptieren.
1962 erlangte Algerien die nationale Unabhängigkeit. Zuvor hatten Frankreich und die Milizen der „colons“ – der weißen Siedler – ihre Grausamkeiten maßlos gesteigert und auch ins „Mutterland“ heim geholt. Im Oktober 1961 massakrierten französische Polizisten hunderte algerische Demonstranten mitten in Paris. Die Leichen wurden teils in die Seine geworfen und trieben durch die Stadt.
Zu einem Einlenken waren die französischen Kolonialherren gegenüber den AlgerierInnen nur bereit, wenn ihnen die Ausbeutung der Bodenschätze weiterhin garantiert würde. Französische Konzerne konnten weitere Extraprofite realisieren. Als das unabhängige Algerien 1971 die Nationalisierung der Erdöl- und Erdgasindustrie vorantrieb, verhängte Frankreich einen Wirtschaftsboykott. Der Befreiungskrieg prägte das nationale antikoloniale Bewusstsein vieler – vor allem älterer – AlgerierInnen: diese haben wahrgenommen, dass Frankreich mit ihnen gänzlich anders verfuhr, als mit den einstigen deutschen Kriegsgegnern. Das junge unabhängige Algerien hatte die seit 1830 währenden ökonomischen und sozialen Folgen der Ausbeutung des Landes, die Lasten des Weltkrieges und die Zerstörungen des Unabhängigkeitskrieges als Hypotheken alleine zu bewältigen. Die deutschen Verantwortlichen für Weltkrieg und Massenvernichtung wurden hingegen mit Aufbauplänen und Westintegration aufgepäppelt und in die Reihen der imperialistischen Militär- und Wirtschaftsbündnisse aufgenommen.
Die Nachbarstaaten Marokko und Tunesien wurden nicht zuletzt wegen des Algerienkrieges in die Unabhängigkeit „entlassen“. Wie in vielen anderen Weltregionen auch wurde eine regionale rechte Elite fortan mit der Herrschaft über die einstigen Kolonien betraut. Mit diesen postkolonialen Staaten modernisierte der Westen die Form seiner Herrschaft und erhielt so vielerorts das Wesen der imperialistischen Ausbeutung und Einflussnahme bis heute aufrecht.
Während dieses Befreiungskrieges entstanden in Algerien wichtige Impulse für die Diskussionen v. a. in Afrika. Der internationale Sprecher der FLN Frantz Fanon schrieb sein Werk „Die Verdammten dieser Erde“, das als „Kommunistisches Manifest der antikolonialen Revolution“ Verbreitung fand. „Das ist es, was Fanon seinen afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Brüdern auseinandersetzt: Entweder wir verwirklichen alle gemeinsam und überall den revolutionären Sozialismus, oder wir werden einer nach dem anderen durch unsere ehemaligen Tyrannen geschlagen werden“, schrieb Jean-Paul Sartre in seinem Vorwort des Buches. An die europäischen LeserInnen gewandt fuhr er fort: „Bisher waren wir Subjekte der Geschichte, jetzt sind wir die Objekte. Das Kräfteverhältnis hat sich umgekehrt, die Dekolonisation hat begonnen. Alles, was unsere Söldner tun können, ist, deren Vollendung zu verzögern.“
Die Algerien-Solidarität der 1950er Jahre war eine der ersten internationalistischen Solidaritätsbewegungen innerhalb der westdeutschen Linken nach dem Faschismus. Die überschaubare Anzahl von etwa 300 AktivistInnen leistete Öffentlichkeitsarbeit, transportierte Geld, Personen oder Materialien für die FLN und verhalf 4.000 kriegsmüden Deutschen in der französischen Fremdenlegion zur Flucht. Durch Sabotage versuchte die FLN-Solidarität zudem „im Herzen der Bestie“ die französische Wirtschaft zu destabilisieren. Die Hoffnungen der InternationalistInnen bauten auf den emanzipatorischen Charakter, den Teile des nationalen Befreiungskampfes in sich trugen. 1956 wurde auf einem FLN-Kongress die soziale Revolution diskutiert. Selbstreflektierend hielten die Solidaritäts-AktivistInnen später fest, dass die Verlagerung der Hoffnung auf ein Objekt der Befreiung in anderen Ländern auch ein Reflex auf die Resignation nach dem KPD-Verbot 1956 und die Stagnation von Klassenkämpfen in der BRD waren. In Algerien blieb nach der nationalen Befreiung von der sozialen Revolution allerdings nicht viel übrig. Schon 1965 stellten deutsche InternationalistInnen fest, dass sich ihre fortschrittlichen GenossInnen, die mit ihnen über Sozialismus und die Emanzipation von Frauen diskutiert hatten, innerhalb der neuen Situation nicht durchsetzen konnten. Trotz sozialistischer Elemente im neuen Algerien dominierten Militär, Bürokratismus und Korruption. „Wir mussten feststellen, dass es leichter ist sich mit Unterdrückten zu solidarisieren als mit den Verhältnissen nach einer Befreiung“, resümierten InternationalistInnen ihre enttäuschte Erwartungshaltung.
Diese Erfahrungen der postkolonialen Zeit nahm Frantz Fanon 1961 in seinem Werk bereits vorweg, indem er zugleich anstachelnd und mahnend schreibt: „Los, meine Kampfgefährten, es ist besser, wenn wir uns sofort entschließen den Kurs zu ändern. Die große Nacht, in der wir versunken waren, müssen wir abschütteln und hinter uns lassen. Der neue Tag, der sich schon am Horizont zeigt, muss uns standhaft, aufgeweckt und entschlossen antreffen. (...) Los Genossen, Europa hat endgültig ausgespielt, es muss etwas anderes gefunden werden. Wir können heute alles tun, vorausgesetzt, dass wir nicht Europa nachäffen, vorausgesetzt, dass wir nicht von der Begierde besessen sind, Europa einzuholen“.
Zum Weiterlesen
Unsere Opfer zählen nicht. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Vom Rheinischen JournalistInnenbüro
Hoch die internationale Solidarität. Von Balsen, Werner und Karl Rössel
Tennô-Faschismus. Zur Entstehung, Struktur, Ideologie und Funktion des Herrschaftssystems in Japan, 1868–1945. Von Kong Kwang-Duk
My side of History. Von Chin Peng
Life as the River flows. Women in the Malayan Anti-Colonial Struggle. Von Khoo, Agnes
Der Zweite Weltkrieg als kolonialer Wendepunkt und Katalysator für antikoloniale Bestrebungen. Von Klose, Fabian In: Menschenrechte im Schatten kolonialer Gewalt. Die Dekolonisierungskriege in Kenia und Algerien 1945-1962.
Frantz Fanon. Ein Porträt. Von Cherki, Alice
Die Verdammten dieser Erde. Von Fanon, Frantz
Kofferträger. Das Algerien-Projekt der Linken im Adenauer-Deutschland. Von Leggewie, Claus
Zur Zukunft der antifaschistischen Erinnerungskultur
Nach den Ausführungen zu unseren Verständnisweisen zu bundesdeutscher, regionaler und internationaler Geschichtspolitik wollen wir nun zum Abschluss Fragestellungen der Erinnerungskultur und Geschichtsweitergabe am Scheidepunkt der Geschichte diskutieren. Alle, denen es ein Anliegen ist, die Leiden der Opfergruppen und die Lehren der WiderstandskämpferInnen zukünftigen Generationen nahe zu bringen, sind vor die Aufgabe gestellt, Formen und Wege der Vermittlung zu suchen.
Wir stellen den historischen antifaschistischen Widerstand ins Zentrum unseres Interesses. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wir selber begreifen uns in der Gegenwart im Widerstand gegen die Gefahren des Neofaschismus und gegenüber den gesellschaftlichen Umständen, die autoritäre, menschenfeindliche und kriegstreiberische Tendenzen begünstigen. Es ist unser tiefstes Interesse, von den Erfahrungen jener Menschen zu lernen, die sich in dunkelster Ausweglosigkeit und höchster Gefahr zum Handeln gegen die „deutsche Volksgemeinschaft“, gegen industriellen Massenmord sowie Raub- und Vernichtungskrieg entschieden haben. „Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: NEIN“ (Kurt Tucholsky). Es geht uns um Würde und den aufrechten Gang, aber auch darum, Widersprüche auszuhalten sowie von den Organisations- und Kampferfahrungen im antifaschistischen Widerstand zu lernen. Dafür sind die letzten lebenden ZeugInnen dieses Widerstands unendlich wertvoll. Das Wissen um ihr Wirken müssen sich heutige Generationen neu erarbeiten. Wie können wir uns ihre Geschichte des antifaschistischen Widerstandes aneignen, als unsere begreifen und vor allem an junge Menschen weitertragen?
Zum Beispiel:
Begegnung mit den letzten lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
In diesen Jahren bieten sich die wahrscheinlich letzten Gelegenheiten der Begegnung mit den ZeitzeugInnen des historischen antifaschistischen Widerstands. Unsere Bemühungen sollten daher darauf abzielen, diese Chancen nicht verstreichen zu lassen, sondern Treffen und Veranstaltungen gezielt zu organisieren oder zu besuchen. Viele Überlebende des Faschismus geben ihr politisches Erbe innerhalb ihrer Familien – an ihre Kinder oder Enkelkinder – weiter. Doch das Vermächtnis der antifaschistischen WiderstandskämpferInnen könnte ebenso durch all jene weitergetragen werden, die zukünftigen Generationen von ihren Begegnungen mit den ZeitzeugInnen berichten; als ZeugInnen der ZeitzeugInnen.
Zum Beispiel:
Authentische Orte der Erinnerung und des Gedenkens gestalten
Diskussionen um Formen der Erinnerungskultur finden mit einer besonderen Vehemenz in den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager statt. Grundsätzlich ist zu überlegen, ob und wie sich AntifaschistInnen in die Ausgestaltung zum Beispiel von Gedenkfeiern einbringen wollen. Eine Möglichkeit ist die Gestaltung von Feiern, die fernab der offiziellen Feielichkeiten stattfinden.
Wichtig für ein Ausloten, wie die Gedenkkultur in diesen Institutionen beeinflusst werden kann, ist z.B. die Struktur der Gedenkstätten. In einigen bundesdeutschen Gedenkstätten ist eine Mitgestaltung einfacher umzusetzen als in anderen. Die Gedenkstätte für die insgesamt 15 Emsland- oder Moorlager in Esterwegen wurde beispielsweise von einem Verein aufgebaut (und erst Ende 2011 eröffnet, also 66 Jahre nach der Befreiung der Lager!). Die meisten anderen Gedenkstätten befinden sich allerdings in der Hand von Landesträgern, so dass immer auch eine staatsideologische Haltung in den Gedenkstätten umgesetzt werden soll bzw. ausgefochten wird.
Aber auch regional ist es an uns, uns in Auseinandersetzungen um Erinnerungskultur und die Rolle von authentischen Orten einzumischen. In Göttingen entwickelt sich seit Mai 2012 eine konstruktive Diskussion um die Würdigung antifaschistischer WiderstandskämpferInnen im öffentlichen Stadtbild. Im Zentrum von Diskussionen steht das alte Stadthaus in der Gotmarstraße 8. In diesem Gebäude befindet sich heute die Stadtbibliothek, im deutschen Faschismus residierte dort u. a. die Polizei. Mindestens 80 AntifaschistInnen wurden zwischen März bis August 1933 im Zuge der sog. Schutzhaftwelle in das Gebäude verschleppt und z.T. von hier weiter in das KZ Moringen gebracht. Die zentrale und öffentliche Lage des Gebäudes mit seinen authentischen Kellern und Innenhöfen bietet sich für einen regionalen Erinnerungsort zum antifaschistischen Widerstand an. Bei einer Gestaltung dieses Ortes, an dem wir mitwirken, ist es uns wichtig, dass Namen und Zusammenhänge benannt werden, damit historische Tatsachen nicht hinter nichtssagenden Formulierungen verwischt werden, wie es oft der Fall ist.
Zum Beispiel:
Die eigene Bewegungsgeschichte recherchieren und aufbereiten
Um authentische Orte der Erinnerung gestalten zu können, muss die Geschichte dazu auch bekannt sein und mit Leben gefüllt werden können. Die staatstragenden Eliten haben kein Interesse daran, antifaschistische Widerstandsgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deshalb ist es unsere eigene Aufgabe, unsere Bewegungsgeschichte zu recherchieren, um sie weitergeben und weiterschreiben zu können. Auch wenn dies sehr aufwendig ist, ist es doch notwendig. Denn die Deutungsmacht über die Geschichte des Faschismus wird sich in den nächsten Jahren noch weiter zu Gunsten der staatstragenden Eliten verschieben. Dem sollten wir durch eigene Kenntnisse und Kompetenzen, allem voran durch eigene Recherchen, gegenarbeiten. Zumindest auf der regionalen Ebene können so neue Widerstandsgeschichten erzählt werden.
Zum Beispiel:
Medien für die Zukunft entwickeln
Dokumente von Opfern des Faschismus und antifaschistischen WiderstandskämpferInnen liegen vielfach vor. Viele ZeitzeugInnen haben ihre Erlebnisse in Romanen und Sachbüchern wiedergegeben. Auch Interviews wurden vielfach als Ton- und Filmbeiträge aufgezeichnet. Häufig sind diese Materialien aber unbearbeitet, d. h. sie liegen als Rohmaterialien in Archiven und müssen zeitaufwendig aufbereitet werden. Doch wer nimmt sich dieser Aufgabe an? Welches sind die Medien, die zukünftige Generationen nutzen werden? Wie werden sich ihre Seh- und Hörgewohnheiten entwickeln? Eine Antwort liefert das European Resistance Archive (ERA), das vom italienischen Geschichtsinstitut ISTOREO entwickelt wurde: Die Internetplattform bietet Biographien, Hintergrundinformationen und Videos von KämpferInnen aus dem europäischen Widerstand gegen den Faschismus an.
www.resistance-archive.org
Stadtplan von Göttingen. Historischer antifaschistischer Widerstand: Wirkstätten, Biographien, Gedenkorte
Wir haben einen Stadtplan von Göttingen erstellt, der einen Überblick über verschiedene Orte des historischen antifaschistischen Widerstands aufzeigt. Schwerpunkt der Wirkstätten bildet die Zeit vor, während und nach dem deutschen Faschismus, also in den 1920er bis 1940er Jahren. Um den alltagspraktischen Nutzen zu erhöhen, bildet der Stadtplan auch linke Infrastruktur und einige Orte von Ereignissen der jüngeren Regionalgeschichte seit den 1970er Jahren ab.
Da uns viele ZeitzeugInnen des antifaschistischen Widerstands aus Altergründen vielfach nicht mehr zur Verfügung stehen, ist es an uns, antifaschistische Geschichte sichtbar, erlebbar und vermittelbar zu machen. Der Stadtplan soll einen Beitrag dazu leisten, dass interessierte Menschen sich "ihre Stadt" aneignen und neue Wege einer lebendigen Erinnerungskultur erstreiten.
Ehemalige Wirkstätten des antifaschistischen Widerstands oder der Verfolgung können dabei in der Gegenwart zu authentischen Orten der Erinnerung werden. Durch Stadtspaziergänge können sie in das subjektive und kollektive Bewusstsein gerückt werden.
Hier könnt Ihr Euch den 4-seitigen Stadtplan als pdf downloaden.
Gimmicks
Zusätzlich zum Stadtplan und zur Broschüre gibt es zur Verschönerung des öffentlichen Raums selbstverständlich noch Aufkleber und zwei Arten von Postkarten: das historische Motiv von Lieschen Vogel mit ihren GenossInnen und das neue, grafisch bearbeitete.
Hier und hier könnt Ihr Euch die beiden Postkarten auch als pdf downloaden.
Geschichtspolitische Projekte seit 2010
Hier könnt Ihr Euch unsere geschichtspolitischen Projekte seit 2010 ansehen:
Zur Geschichte des antifaschistischen Widerstands 2010: hier.
"Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg": internationalistische Geschichtspolitik 2011: hier und hier.
80 Jahre Antifaschistische Aktion 2012: hier.
Regionalpolitische Geschichtsschreibung 2012: hier und hier.
Zur Zukunft der Erinnerungskultur 2013: hier.
"111 Namen, 1 Keller, keine Erinnerung": Licht-, Ton- und Solihouetteninstallation 2013: hier.